Es sind nur 17 Stufen in die Tiefe, und jeder Schritt nach vorn führt zurück in die Vergangenheit. Durch eine schwere Stahltür betritt man einen fensterlosen Raum, an der Decke Neonröhren, auf den Tischen Telefone, an der Wand Landkarten und um die Ecke eine alte Schreibmaschine Marke Olympia. Im Schutzbunker unter dem Kitzinger Landratsamt empfängt Jürgen Link den Besucher – und macht erst mal klar, dass das hier etwas Besonderes ist. "Viele Landratsämter", sagt er, "haben ihre Bunker in den letzten Jahren dichtgemacht oder umgenutzt." Link hat sich Zeit genommen, sein kleines Reich zu zeigen, das gar nicht so klein ist, wie man in diesen gut zwei Stunden unter Tage feststellen wird.

Der brutale Überfall Russlands auf die Ukraine und die unverhohlene Drohung Putins mit einem Einsatz von Atomwaffen hat die alte Angst vor einem nuklearen Inferno geschürt. Damit ist auch hierzulande der Schutz der Zivilbevölkerung wieder in den Fokus gerückt. Anders als etwa in der Schweiz, wo es so viele Bunker pro Einwohner gibt wie nirgendwo sonst auf der Welt und auch viele Privathäuser einen Bunker besitzen, wurde in Deutschland in den vergangenen 30 Jahren wenig bis nichts in den Bau von Schutzräumen investiert. Im Gegenteil: Viele der Anlagen sind längst stillgelegt – weil die meisten sich eine Bedrohungslage wie im Kalten Krieg nicht mehr vorstellen konnten oder wollten.
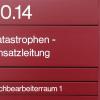
Die Kubakrise führte die Welt 1962 nah an den atomaren Abgrund. Ab 1965 wurde der Bunkerbau in ganz Westdeutschland vorangetrieben. So entstanden über die Jahre bundesweit mehr als 2000 Bunker und Schutzräume: in Tiefgaragen, U-Bahnschächten oder Bahnhöfen. Auch beim Neubau des Kitzinger Landratsamts zu Beginn der 1980er-Jahre förderte der Staat den Bau eines Schutzraums. Dieser war allerdings nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Hier, so malte man sich das zu Zeiten des Kalten Krieges aus, hätte die Landkreis-Führung gemeinsam mit den Chefs von Hilfs- und Rettungsorganisationen, ein Kreis von vielleicht 30 Personen, bei einem möglichen Atomkrieg Stellung beziehen und – ja, was eigentlich tun sollen?
"Durch abgewinkelte Zugänge und eine Stahltür war der Raum gegen Druckwellen geschützt."
Helmut Meyer, früherer Leiter des Katastrophenschutzes
"Die Verwaltungstätigkeit eines Landratsamtes aufrechterhalten, das auch in einer Krise seinen gesetzlichen Aufgaben nachkommen muss", sagt Helmut Meyer. Einem direkten Treffer hätte das Bauwerk aus Expertensicht kaum standgehalten, aber bei einem Nahtreffer in einigen Kilometern Entfernung wäre die Bunkeranlage möglicherweise intakt geblieben. "Durch abgewinkelte Zugänge und eine Stahltür war der Raum gegen Druckwellen geschützt", erklärt Meyer, der bis zu seiner Pensionierung 2014 den Katastrophenschutz im Landratsamt leitete und schon beim Bau des Bunkers Ende der 1980er-Jahre dabei war.
Mindestens zwei Wochen sollten die Überlebenden eines Atomschlages im Bunker ausharren, dann zurück an die Oberfläche und mit Bussen aus der Gefahrenzone gebracht werden, so sahen es die Notfallpläne der Behörden vor. Das klingt absurd, doch die Verstrahlung durch eine Bombe ist tatsächlich weit weniger langfristig als etwa durch die Havarie eines Atomkraftwerks.

319 Quadratmeter misst dieses Schattenreich aus Stahlbeton – denkt man gar nicht, wenn man an einem Vormittag im Juni mit Jürgen Link durch die einzelnen Räume streift. Link ist im Landratsamt als Sachbearbeiter für den Katastrophenschutz zuständig und kennt hier unten jeden Winkel. Vom Empfang im Erdgeschoss führt eine Treppe in den Keller. Über eine Druckschleuse und eine Stahltür gelangt man in die eigentliche Kammer. Der erste Eindruck: erstaunlich unspektakulär.
Der Bunker selbst ist groß, aber erstaunlich unspektakulär
Ein mittelgroßer Raum, grauer Teppichboden, fahles Neonlicht, klinisch weiße Betonwände, ein paar aneinandergereihte Tische, Büroatmosphäre. "Unsere Kommandozentrale", sagt Link. BRK, THW, Feuerwehr – jede Hilfsorganisation hat hier genau ihren Platz. Gleich angrenzend ein weiterer Raum, der mit einer Glasscheibe abgetrennt ist, darin Computer und Monitore älterer Bauart. Er wird heute zu EDV-Schulungszwecken genutzt.

Vom Führungsraum mit der internen Nummer 30.13 geht es in den Fernmeldebereich. Hier stehen zwei Faxgeräte, ein Analog-Funkgerät Marke Telefunken, um bei einem Cyberangriff und einer Sabotage des Digitalfunks gewappnet zu sein, Schreibmaschine und Fernschreiber; hier wäre auch Platz gewesen für einen 10.000-Liter-Wassertank, der aber nie eingebaut wurde. Auch Küche und Schlafräume wurden Ende der 1980er-Jahre, als der Zusammenbruch des Ostblocks abzusehen war, nicht mehr eingerichtet.

Dafür gibt es noch manche Original-Ausrüstungsgegenstände aus der Entstehungszeit: Kombinationsschutzanzüge, Liefermonat Oktober 1989, und ABC-Schutzmasken. Sie lagern in einem Karton hinter einer tonnenschweren, luftdichten Tür, die einen weiteren Raum öffnet. Dicke Rohre führen an der Decke entlang und aus der Wand. Sie gehören zu einer Belüftungsanlage, die Frischluft ansaugen und filtern kann: automatisch und zur Not manuell. Link holt eine Handkurbel hervor und setzt sie an einen der Zylinder. Man darf es selbst versuchen. Schwerfällig setzt sich das Gerät in Bewegung. Eine kleine Lampe beginnt zu leuchten.

Im bayerischen Innenministerium ging man im März 2022, kurz nach Beginn des Kriegs in der Ukraine, davon aus, dass inzwischen der weitaus größte Teil der rund 500 öffentlichen Schutzräume im Freistaat nicht mehr funktionstüchtig ist; viele wurden nicht mehr regelmäßig gewartet, nachdem die Innenministerkonferenz im Mai 2007 entschieden hatte, das Konzept flächendeckender öffentlicher Schutzräume aufzugeben und dafür kein Geld mehr einzuplanen.
Das Bundesinnenministerium will den Bestand der Bunker prüfen
Jetzt, so hieß es im Bundesinnenministerium unter dem Eindruck des russischen Überfalls, wolle man das Rückbaukonzept für Schutzräume prüfen und den aktuellen Bestand erfassen. Angesichts "heutiger Bedrohungslagen" und der sehr geringen Vorwarnzeiten bei einem Raketenangriff stellt sich allerdings nicht nur bei der für die Bauten zuständigen Bundesanstalt für Immobilienangelegenheiten die Frage, wie sinnvoll eine Reaktivierung dieser Bunker noch wäre.

Der Schutzraum unter dem Kitzinger Landratsamt wird immer noch regelmäßig gewartet. Er ist Anlaufstelle für die Rettungsorganisationen bei einem "Großschadensereignis", wie Link es nennt. Lokale Unglücksfälle, die nach dem Gesetz Gefahr für Leib und Leben bedeuten, etwa das Entgleisen eines ICE, eine Explosion im Marktbreiter TEGA-Werk, elementare Hochwasser. Zweimal jährlich wird hier der Ernstfall geprobt, der bislang nie eingetreten ist. Für Jürgen Link aber zählt, dass dieser Raum die vergangenen Jahrzehnte überlebt hat – und dass man "jederzeit einsatzbereit" sei.
Dieser Artikel ist erstmals am 25. Juni 2022, drei Monate nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine, erschienen.
