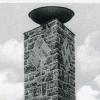Im Frühjahr 1933 hatten sie es geschafft: Nach Jahren des Kampfes feierten die Nationalsozialisten die Machtübernahme im deutschen Staat. Die unterfränkischen Nazis nutzten die Gelegenheit, um bei einer großen Gautagung in Kitzingen eine eindrucksvolle Siegesfeier zu inszenieren. Tausende Parteigenossen zelebrierten die Machtergreifung der NSDAP.
Auf Wunsch von stand diese Siegesfeier ganz im Zeichen eines Mannes, von dem die Nationalsozialisten behaupteten, er sei der erste "Blutzeuge der Bewegung" gewesen, der erste Tote, den die Nazis im politischen Kampf zu beklagen hatten. Die Rede ist vom Kitzinger Daniel Sauer, der vor 100 Jahren, am 1. Mai 1923, am Rande von politischen Ausschreitungen durch einen Pistolenschuss getötet worden war.

Otto Hellmuth, völkischer Agitator der ersten Stunde und später Gauleiter von Mainfranken, war bestrebt, dem Nationalsozialismus einen religiös-kultischen Anstrich zu verleihen. Deshalb kämpfte er in Würzburg energisch gegen die katholische Kirche; daher propagierte er seinen Gau zum "Bauerntraditionsgau" und stilisierte den Bauernkriegsführer Florian Geyer zum "Hitler des Mittelalters" und Vorkämpfer nationalsozialistischer Ideale.
Daniel Sauer zum Nazi-Märtyrer verklärt
Aus diesem Grund erklärte er Daniel Sauer zum "Bahnbrecher des Nationalsozialismus in Franken" und "als leuchtendes Vorbild eines treuen SA-Mannes". Schon 1925 war Sauer Bestandteil des Totengedenkens rund um den Hitler-Putsch (8./9. November 1923); bei den unterfränkischen Gautagen war der Besuch von Sauers Grab am Kitzinger Hauptfriedhof ein fester Programmpunkt. 1932, als die SA reichsweit verboten wurde, gründete Hellmuth eine Tarnorganisation unter dem Namen "Daniel-Sauer-Bund". Schließlich wurde 1938 am Ort des Geschehens in Sickershausen für Sauer errichtet, das nach dem Krieg abgerissen wurde.
Wirklich heimisch wurde dieser Kult im Maindreieck aber nie. Schon die Zeitgenossen fanden die Geschichte obskur und konstruiert. In der Spuchkammerakte des Sohns von Daniel Sauer hieß es, er sei vor Stolz geplatzt, der Sohn des "Blutzeugen" zu sein und habe sich bei der Firma Fehrer, wo er als Vorarbeiter tätig war, als "kleiner Hitler" aufgespielt. Nach dem Krieg leugnete die Familie entschieden, dass Sauer überhaupt Nationalsozialist gewesen sei; er sei Hilfspolizist in Sickershausen gewesen und die Witwe habe daher auch zeit ihres Lebens eine staatliche Rente bezogen.
Der tödliche Schuss von Sickershausen

Die Ermordung Sauers fiel in eine Zeit höchster politischer Spannungen in ganz Mainfranken. Am 28. April 1923 hatte eine Vaterländische Feier rechter Verbände in Hohenfeld stattgefunden. Zeitgleich begingen an zahlreichen Orten der Gegend die Sozialdemokraten ihre Maifeiern. Am Abend des 1. Mai trafen die beiden verfeindeten Gruppen dann in Sickershausen, in der Nähe der Bahnlinie, zusammen. Es kam zu tätlichen Auseinandersetzungen, in deren Verlauf auch Schüsse fielen. Ein Schuss traf Sauer in den Kopf. Zwar hat man sofort einen Güterzug angehalten und Sauer ins Krankenhaus nach Kitzingen gebracht, aber er verstarb noch in der Nacht.
Die völkische Propaganda hatte ihre Version der Geschichte schon in den folgenden Tagen beisammen: Sozialisten und Kommunisten hätten die Dorfbevölkerung tyrannisiert. NSDAPler und Angehörige der Reichsflagge (einer weiteren rechtsradikalen Vereinigung) wären nach Sickershausen geeilt, um die linken Gruppen zu vertreiben. Beim Eintreffen im Ort seien sie von den Sozialdemokraten beschossen worden und Daniel Sauer sei hierbei tödlich verwundet worden. Die Täter habe man nie ermitteln können.
Von Beginn an keimte aber der Verdacht auf, dass Sauer von seinen eigenen Leuten erschossen worden sei. Ein Bericht des Ersten Staatsanwalts beim Landgericht Würzburg vom 3. Mai 1923, der sich in den Akten des Bayerischen Staatsministeriums der Justiz (heute im Bayerischen Hauptstaatsarchiv in München verwahrt) erhalten hat, wirft ein ganz anderes Licht auf die Ereignisse des 1. Mai 1923.
Wurde Sauer von den eigenen Leuten erschossen?

Demnach seien an jenem Tag feiernde Sozialdemokraten auf ihrem Heimweg nach Hohenfeld und Marktbreit durch Sickerhausen gegangen. Dort sei es bereits am Abend, gegen 19 Uhr, zu Auseinandersetzungen mit deutschvölkisch gesinnten Einwohnern gekommen, woraufhin die Sozialdemokraten abgezogen seien. Die Sickershäuser hätten aber dennoch bewaffnete Wachtposten am Ortsrand aufgestellt.
Erst viel später, gegen 21 oder 22 Uhr, sei Sauers Gruppe aus Kitzingen, bestehend aus Mitgliedern von NSDAP und Reichsflagge, über die Bahngleise nach Sickerhausen gegangen. In der Dunkelheit hätten die Wachtposten die Männer für "zurückflutende Sozialdemokraten" gehalten und das Feuer eröffnet. Dabei sei Daniel Sauer dann tödlich getroffen worden.

Tatsächlich konnten einige Täter ermittelt werden. 14 Tage nach dem Vorfall nahm die Staatsanwaltschaft sechs Sickershäuser Bürger sowie den ehemaligen Kapitänleutnant Heim aus Wässerndorf wegen Totschlags in Haft. Allerdings wurde die Anklage kurz darauf fallengelassen. Die Sickerhäuser Wachtposten, so hieß es lapidar im Bericht des Staatsanwalts, hätten Sauer und seine Männer für Sozialdemokraten gehalten; daher handele es sich bei dem Vorfall um Notwehr.
Ein Sinnbild für den Untergang der Weimarer Republik

Außerdem müsse man bedenken, dass es bereits in den Tagen davor Gewalttaten von linken Gruppen gegeben habe; das erkläre die rüde Reaktion der Sickerhäuser Bevölkerung. Der Appell des Oberstaatsanwalts in Bamberg, doch einmal zu schauen, woher die Leute ihre Schusswaffen hätten und ob es verbotene Waffenlager gebe, verhallte ungehört.
Die Bluttat steht damit sinnbildlich für die Fehlentwicklungen, die die Weimarer Republik am Ende zu Fall brachten: politische Auseinandersetzungen, die mit Taten statt mit Worten ausgefochten wurden; das Anwachsen radikaler Stimmungen; ein Staatsapparat, der nichts willens und nicht in der Lage war, die Gegner der Demokratie angemessen zu verfolgen und zu bestrafen, und eine dreiste Nazi-Propaganda, die nicht davor zurückschreckte, die Tatsachen zu verdrehen und die Wahrheit zu verbiegen, um für sich eine günstige Stimmung zu machen.
Dr. Alexander WolzDer Historiker und Gastautor ist 1979 in Dettelbach geboren und aufgewachsen in Kitzingen. Nach dem Abitur am Armin-Knab-Gymnasium besuchte Alexander Wolz die Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern in Hof. In Würzburg studierte er Neuere und Neueste Geschichte, Geschichte des Mittelalters, Volkskunde/Europäische Ethnologie und promovierte am Lehrstuhl für Neueste Geschichte und Didaktik der Geschichte.Nach Tätigkeiten als Lehrbeauftragter der Uni Würzburg und im Stadtarchiv Lohr folgte der Vorbereitungsdienst für den Einstieg in die Fachlaufbahn Bildung und Wissenschaft, fachlicher Schwerpunkt Archivwesen. Wolz wurde 2016 Archivrat, leitete bis 2021 das Staatsarchiv Coburg und ist seit September 2021 Leiter des Staatsarchivs Würzburg.Wolz' Opa Wilhelm Sauer (1929 – 2021) war der Enkel von Daniel Sauer. Dr. Alexander Wolz ist der Ur-Ur-Enkel von Daniel Sauer.Quelle: Alexander Wolz