Die Ludwigsbahn zwischen Nürnberg und Fürth war 1835 die erste Eisenbahnstrecke in Deutschland. Knapp 20 Jahre später dampften auch durch Unterfranken die ersten Lokomotiven, auf der Ludwigs-West-Bahn von Bamberg über Schweinfurt und Würzburg nach Aschaffenburg. Im heutigen Main-Spessart stellte der Bau die Planer vor besondere Herausforderungen. Durch weitere Bahnstrecken in den Jahrzehnten danach wurde Gemünden zu einem wichtigen Knotenpunkt.
In den Jahren nach den ersten Fahrten des berühmten "Adler" zwischen Nürnberg und Fürth entstanden Pläne für den Aufbau eines Schienennetzes im damaligen Königreich Bayern. Am 12. Dezember 1843 präsentierte der unterfränkische Kreisingenieur Karl Schierling seinen Streckenvorschlag für den Bau einer Bahnstrecke am Main entlang. Schierling kannte die Gegend so gut, dass er für diese Planung keine detaillierten Karten oder eine Terrainerkundung brauchte, was sonst für solche Projekte üblich wäre.
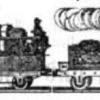
Noch an Weihnachten desselben Jahres genehmigte König Ludwig I. von Bayern grundsätzlich den Bau. Vorher hatte er lange versucht, den Bau einer Eisenbahnstrecke entlang des Flusses zu verhindern, um stattdessen die kostengünstige Binnenschifffahrt zu fördern. Erst als offensichtlich wurde, dass diese der Bahn nicht gewachsen war, gab der König seinen Widerstand auf. National-Ökonom Friedrich List aus Reutlingen, nach dem das Gymnasium in Gemünden benannt ist, hatte aufgrund seiner Erfahrungen im amerikanischen Exil den Aufbau eines bayerischen Eisenbahn-Netzes empfohlen. 1844 wurde die Königlich Bayerische Staatsbahn gegründet, am 23. März 1846 beschloss das Parlament das Gesetz zum Bau der "Ludwigs-West-Bahn".
Dampflock schaffte 1845 etwa 65 Stundenkilometer
Der Baubeginn verzögerte sich durch das Revolutionsjahr 1848. Am 1. August 1852 konnte mit der Strecke von Bamberg nach Haßfurt der erste Abschnitt eröffnet werden. Am 3. November desselben Jahres folgte der Abschnitt von Haßfurt nach Schweinfurt, 1854 kamen die Abschnitte von Schweinfurt nach Würzburg und kurz darauf, am 1. Oktober 1854, von Würzburg nach Aschaffenburg hinzu – bis zur Landesgrenze bei Kahl. 65 Stundenkilometer schafften die relativ kleinen Dampfloks damals, Toiletten waren in den Waggons noch Fehlanzeige.
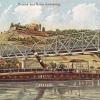
Weil die Talsohle südlich von Würzburg abschnittsweise nicht besonders breit war und weil stärker bevölkerte Siedlungen am Main die Ideallinie einer Eisenbahntrasse versperrten, waren kostspielige Maßnahmen nötig. Bei Retzbach und Gambach sowie "an den zwischen Fluß und Berg eingekeilten Orten Wernfeld und Gemünden", am Zollhaus Zwing zwischen Wernfeld und Gemünden und bei Langenprozelten mussten die Flächen für die zweispurige Strecke dem Fluss abgenommen werden. Am Kalbenstein zwischen Karlstadt und Gambach wurden zunächst Geländekorrekturen und der Kauf von Weinbergen vorgesehen, die Strecke aber dann doch Richtung Mainufer verlegt. Bahndämme wurden aufgeschüttet.

Station in Langenprozelten wurde erst nachträglich hinzugefügt
Der Bahnhof in Karlstadt hätte ursprünglich, wie in Lohr, weiter von der Altstadt entfernt entstehen sollen. Dem Karlstadter Magistrat gelang es jedoch nach hartem Ringen, den Bahnhof näher an die Stadt heranzurücken. In Gemünden wurde der Bahnhof auf der weitgehend hochwasserfreien Terrasse im Südosten der Stadt gebaut, gegenüber vom heutigen Verlag Hofmann. Auch zwischen Langenprozelten und Lohr musste ein Bahndamm am Fluss aufgeschüttet werden.
Den Bahnhalt in Langenprozelten gab es bei Eröffnung der Strecke 1854 noch nicht. Erst 1878 wurde eine Haltestation genehmigt, weil die Langenprozeltener keine Ruhe gegeben hatten. Sie hatten ihren Wunsch nach einem eigenen Bahnhof mit dem Holzhandel als einziger Erwerbsquelle und dem jährlich zweimal wiederkehrenden Hochwasser begründet, das ihnen den Weg nach Gemünden für einige Zeit abschnitt.
Arbeiter beim Schläfchen in der Pause tödlich verletzt
Sackenbach, das bergseitig umfahren wird, und Lohr mit seinem weit außerhalb gelegenen Bahnhof hatten das Pech, dass der Anstieg nach Heigenbrücken möglichst flach gehalten werden sollte. Zwischen Lohr und Heigenbrücken mussten fünf Spessarttäler gequert werden, damit die Steigung nicht zu steil ausfiel. Auch der Halt in Partenstein war zunächst nicht vorgesehen. Die Gemeinde argumentierte mit der "bekannten Armuth und ökonomischen Gesunkenheit" Partensteins. Die Regierung von Unterfranken und Aschaffenburg unterstützte den Antrag Partensteins, aber die Eisenbahnbau-Kommission blieb zunächst hart. Bei einer Revision der Streckenpläne 1852 lenkte die Kommission dann doch ein und nahm Partenstein als Halt mit auf.
Zwar war die Strecke von Anfang an zweigleisig vorgesehen, allerdings waren 1854 nur Steilstrecken bei Rottendorf und Heigenbrücken zweigleisig. Erst zum 1. November 1864 folgte der zweigleisige Ausbau im Abschnitt Würzburg–Retzbach und 1869 erst auf der langen Strecke von Retzbach bis Heigenbrücken.

Am 11. Mai 1869 kam es auf der Bahnstrecke bei Krommenthal zu einem Unglücksfall. Mehrere Arbeiter aus Neuhütten waren dort damit beschäftigt, Felsen für das zweite Gleis zu sprengen. Nach dem Mittagessen legten sie sich an jenem schwülen Tag unmittelbar neben den bestehenden Schienenstrang zur Ruhe und schliefen ein. Der Lokführer des Eilzugs aus Aschaffenburg bemerkte durch die vielen Kurven die schlafenden Arbeiter zu spät, gab noch ein Warnsignal mit der Dampfpfeife ab, aber schon versetzte die Lok einem Arbeiter einen tödlichen Stoß gegen den Kopf.
Keine Tanzveranstaltungen für Bahnarbeiter
Zum damaligen Zeitpunkt waren bereits weitere Strecken in der Gegend in Planung. Vor allem von Seiten Preußens, das 1866 die Regierungsgeschäfte in Kurhessen übernommen hatte, wollte man die Sinngrundbahn. Schließlich ließ sich auch Bayern breitschlagen. Beim Bau waren viele Arbeiter aus Italien dabei, die oft ihre ganze Familie mitbrachten, ansonsten größtenteils Niederbayern, Oberpfälzer und Tiroler. Reibereien blieben nicht aus.

Ein Gendarmeriekommandant bat 1869 angesichts von 130 bis 140 Eisenbahnarbeitern in Obersinn, "aufgeregte und gern reizbare Menschen", keine Tanzmusik durchzuführen, um die Gemüter der Arbeiter nicht weiter zu erhitzen. Das war vielleicht gar keine so dumme Idee, wie ein Vorfall im Januar 1870 zeigte, wo es in einer Gastwirtschaft bei einem Vereinsball zu einer Schlägerei mit ungebetenen Gästen kam, nach der von der Wirtschaft nur noch Kleinholz übrig gewesen sein soll. Als Folge wurde auch in anderen Orten des Sinngrunds der Schnapsausschank beschränkt und Tanzveranstaltungen verboten. Im Juni 1870 gab es in Mittelsinn eine nächtliche Demonstration gegen die Bauarbeiter.
Strecke Gemünden–Elm "eine der interessantesten Gebirgsbahnen"
Aus Rücksicht auf die "kostbaren Wässerwiesen" an der Sinn wurde bei Rieneck ein Tunnel gebaut. Nördlich von Obersinn an der Grenze zu Preußen entstand – durch die Höhenlage der Wasserscheide bei Sterbfritz bedingt – eine hohe Sinntalbrücke. Beide Bauwerke galten damals als Meisterwerke der Baukunst. Die Eröffnung der Strecke Gemünden–Elm, "eine der interessantesten Gebirgsbahnen" der letzten Jahre, wie eine Zeitung damals schrieb, war am 6. Mai 1872. Bayerische Bahnhöfe waren Rieneck, Burgsinn und Mittelsinn. Der Verkehr auf dem zunächst eingleisigen "Preußenbähnle" – die Strecke wurde von Preußen verwaltet und die Züge waren preußisch – war anfangs überschaubar. Erst in den 1930ern wurde die Strecke zweigleisig ausgebaut.
Gemünden wurde jetzt zum Eisenbahnknotenpunkt. Für die nötige Erweiterung musste der Berg zum Teil abgetragen werden. Ein neuer Bahnhof und neue Betriebsgebäude mussten her, der unweit davon stehende kleinere, alte Bahnhof wurde, als Endpunkt der Sinntalbahn, zum "Preußischen Bahnhof" (1976 abgerissen). Große Erdmassen wurden bewegt.

Werntalbahn sollte Würzburg entlasten
Am 15. Mai 1879 kam die Werntalbahn zwischen Gemünden und Schweinfurt dazu. Ein erklärtes Motiv für die Bahn war die von Militärs geforderte Streckenverkürzung zwischen Schweinfurt und Gemünden und die Entlastung des Knotenpunkts Würzburg. Der Personenverkehr auf der Strecke nahm in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ab, schließlich wurde er Ende Mai 1976 komplett eingestellt. Im Güterverkehr hat die Werntalbahn als Umgehungsbahn des Knotens Würzburg ihre Bedeutung jedoch nie verloren.
Und 1884 wurde noch die Stichbahn Gemünden–Hammelburg als erste "Localbahn" Bayerns, einer Sparversion im Gegensatz zu einer "Vollbahn", eröffnet. Die Strecke wurde . Über die Saaletalbahn wurde etwa .
Gemünden wurde zu einer Eisenbahnerstadt, viele Hundert Arbeitsplätze entstanden, eine Industrialisierung blieb dort trotz Eisenbahnknotenpunkt aber zunächst aus, unter anderem weil hochwasserfreie Flächen fehlten. Andernorts, etwa in Partenstein oder Karlstadt, setzten Industrialisierung und Bergbau (Gewinnung von Schwerspat) nach der Anbindung an die Bahn in größerem Umfang ein.
Große Hoffnungen in die Linie Lohr-Wertheim gesetzt
Nicht vergessen wollen wir die am 1. Oktober 1881 eröffnete Strecke zwischen Lohr und Wertheim. Der ursprünglich nicht vorgesehene Bahnhof Lohr-Stadt wurde erst ein Jahr später, am 15. Oktober 1882, eröffnet. Außer den unmittelbaren Anliegergemeinden hatten sich an den Projektierungskosten auch Karbach, Marienbrunn, Sendelbach, Wombach, Windheim und Zimmern beteiligt. Große Hoffnungen knüpften sich an die Bahn.
Schon in den Anfangsjahren jedoch war die Linie Lohr-Wertheim eine der "schlechtest frequentierten Strecken des ganzen bayerischen Eisenbahnnetzes", wie die Betriebsabteilung der Königlich-Bayerischen Verkehrsanstalten im Mai 1885 dem Lohrer Stadtrat mitteilte. 1976 wurde der Personenverkehr eingestellt, 1977 auch zwischen Lohr Bahnhof und Lohr-Stadt. 1993 wurde die Strecke stillgelegt und abgebaut, nur zwischen dem Lohrer Bahnhof und dem Industriegebiet-Süd findet heute noch Güterverkehr statt.
Und inzwischen gibt es selbstverständlich die Schnellbahntrasse zwischen Würzburg und Hannover (in Betrieb seit 1988) sowie den Abzweig über die Nantenbacher Kurve nach Frankfurt (1994). Und, wer weiß, vielleicht fahren dereinst wieder Personenzüge auf der Werntalbahn und nach Lohr-Stadt.
Literatur: Schäfer, Hans Peter: "Die Entstehung des mainfränkischen Eisenbahn-Netzes"; Dietrich, Hans: "Gemünden und die Eisenbahn" (Historischer Verein Gemünden); Dietrich, Hans: "Das Preußenbähnle" (in: "1000 Jahre Burgsinn).
Lesetipp: Den Einstieg in die Serie verpasst? Die bisher erschienenen Serienteile finden Sie unter https://www.mainpost.de/dossier/geschichte-der-region-main-spessart/
