"Ich bin ein Töpfer und eines Töpfers Sohn. Gott schuf den Adam schon aus Ton", wird als Leitspruch des Hafenlohrer Töpfers David Hettiger (1876-1957) überliefert. Ihm gelang es, das traditionelle Töpferhandwerk und Hafenlohr, seinen Wohn- und Arbeitsmittelpunkt, über den Nahbereich hinaus bekannt zu machen.
Seit 1376 führte der zur Unterscheidung von der Stadt Lohr Niederlohr genannte Ort zunächst nur gelegentlich, vom 15. Jahrhundert an aber bis heute einen Namen, der die Verbindung mit der Hafnerei, wie das Töpferhandwerk im Süddeutschen bezeichnet wird, deutlich macht: Häfnerlohr, Hafenlohr. Deshalb ziert auch das Hafenlohrer Wappen ein großer Henkeltopf, besser: ein großer Milchhafen.
Tongruben gab es am Achtelsberg
Die seit dem späten Mittelalter in Hafenlohr wohnhaften und tätigen Töpfer nutzten wie örtliche Ansiedler Jahrhunderte zuvor die örtlichen Tongruben am Achtelsberg und an der Straße von Hafenlohr nach Marienbrunn. In einem Zeitungsbericht der 1950er Jahre heißt es: "Noch heutzutage graben die Töpfer dort östlich von der Marienbrunner Straße am 'Sandrain' in einer Tiefe von etwa zwölf Metern, überlagert von mehreren Schichten gelben, weißen und rostfarbenen Sandes, die alle erst weggeräumt werden müssen, abgedeckt von einer bläulichen Tonschicht, nach ihrem Werkstoff, dem grauen Ton für einfachere Erzeugnisse und den weißen Ton für besseres Geschirr."
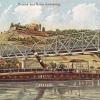
Die Hafnerei, eines der ersten Handwerke der Menschheitsgeschichte, war früher weit verbreitet, überall, wo guter Ton zur Verfügung stand. 1814/15 gab es in der unmittelbaren Umgebung in Homburg fünf, in Marktheidenfeld zwei, in Lengfurt einen, in Hafenlohr neun und in Rothenfels drei Hafnermeister. In Marktheidenfeld, Hafenlohr gegenüber, sind vom 16. Jahrhundert an mehrere Töpferbetriebe nachweisbar. Diese Betriebe lagen wegen der Brandgefahr vor dem ursprünglichen Mitteltor und ihre "Hafengrube", heute durchschnitten vom Nordring, ist noch heute als Geländevertiefung nachweisbar.
Früher als in Hafenlohr endete in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts die jahrhundertelange Tradition. Die Konkurrenz mit eisernen Töpfen und Porzellangeschirr verdrängt zunehmend die Produkte des traditionellen Hafnergewerbes. Schließlich blieb nur die künstlerische volkstümliche Nische.

In Hafenlohr konnte sich die Hafnerei, die besonders von verschiedenen Zweigen der Familie Hettiger geprägt wurde, länger behaupten. Nicht zuletzt, weil David Hettiger sie mit seiner Werkstatt noch einmal zu besonderer Blüte führte. In der Werkstatt seines Vaters Adam Friedrich Hettiger (1839-1920), der früh die besondere Begabung seines Sohnes erkannte, eignete sich David Hettiger durch Mithilfe im Betrieb alle nötigen Kenntnisse zu "Form, Bemalung, Glasur und Brand" an. Schon früh trug er seinen Teil zur Verkaufsware auf der Würzburger Häfelesmesse bei.
David Hettiger war ein Künstler
Doch er blieb nicht bei den traditionellen Formen und Farben stehen, sondern setzte sich künstlerisch mit seinem Handwerk auseinander. Zunächst sah es so aus, als ob David nicht der Hafnerei verbunden bleiben würde, schließlich war er nicht der einzige Sohn, sondern es gab noch drei ältere Brüder. Als Lehrling kam er 14-jährig nach Würzburg in eine Gärtnerei. Erst als einer seiner Brüder bei Holzarbeiten verunglückte, ein anderer auswanderte und der dritte sich für die Eisenbahn entschied, kam David zur Hafnerei zurück. Letztlich war auch eine schwere Erkrankung seines Vaters für die Rückkehr zur Töpferscheibe und nach Hafenlohr ausschlaggebend.

Allein auf sich gestellt vermochte er sich künstlerisch weiterzuentwickeln. Wie Ernst A. Englert feststellt, stellte er dünnwandigere Gefäße her, "erdachte neue Ornamentformen, versuchte sich in neuen Farbzusammenstellungen und probierte neue Glasurrezepte, die eine noch größere Leuchtkraft der bunten Teller- und Schüsselflächen ergaben." Dies machte den jungen Töpfer schnell bekannt, der auch noch die Zeit gefunden hatte, sich durch Besuch der Zeichenschule in Rothenfels fortzubilden. Die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, den er als Soldat miterlebt hatte, war nach einer Durststrecke unmittelbar nach Kriegsende die große Zeit von David Hettiger.

Weithin bekannt wurde er, als er 1925 auf der Töpferscheibe eine Blumenvase von zwei Meter Höhe und 1,30 Meter Durchmesser "vorzüglich in der Form und Ornamentierung" zu drehen vermochte, "den größten Krug der Welt". Alle großen Zeitungen Deutschlands berichteten darüber, sogar englischen und amerikanischen Zeitschriften war das Riesengefäß eine Nachricht wert. Leider konnte der Krug nicht gebrannt werden, denn er passte nicht in den Brennofen.
In der Folgezeit waren David Hettiger und seine Werkstatt ein Begriff. Die Farb- und Formschönheit seines Geschirrs zog die Kundschaft an. Heimat- und Volkstumsforscher suchten seine Werkstatt auf. Ende der 1920er Jahre stellte er in der Otto-Richter-Halle in Würzburg und in der Landesgewerbeanstalt in Nürnberg aus. 1934 zeigte er seine Töpferkunst im Europahaus in Berlin.
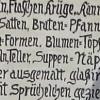
Der Bayerische Rundfunk wollte 1963 sogar wissen, dass David Hettiger "in den 1920er und 30er Jahren seine Teller, Krüge und Geschirr-Teile auf Ausstellungen in ganz Europa" präsentierte. Sein Ruhm strahlte jedenfalls ins Ausland aus; aus England und Amerika gingen Bestellungen ein. Hafenlohr wurde ein Begriff, zumal auch die anderen Häfner sich am Vorbild von David Hettiger orientierten.
Marianne Riedel, Hafenlohr, verzeichnet 2002 als Produkte der Werkstatt: "Neben gewöhnlichem Geschirr fertigte er auch Kacheln. Des Weiteren töpferte er Schüsseln, Kaffeetassen, Mostkrüge, Aschenbecher, Milchhafen, flache Tiegel (Rütscher), Dampftiegel, Petersilien- und Schnittlauchtöpfe für den Wintervorrat, Weihwasserkessel, Windlichter, Trichter, handmodellierte Heiligenfiguren, Märtyrerbilder, Kreuzigungsgruppen, Wappen- und Familienteller, Gugaxe (Pfeifen) und Rußteufel. > Auch Dachfirstfiguren wie Gockel oder Kuckuck, Urnen, Schnapshafen, Gänse- und Hasenbratpfannen gehörten zum Sortiment." Schließlich noch Schmuckteller mit Bildern der Minnesänger oder mit ausgewählten Sprüchen.
David Hettiger selbst blieb trotz seiner Erfolge und seiner Berühmtheit bescheiden und heimatverbunden. Das Angebot einer Kölner Keramikfabrik lehnte er ab. Allerdings führte er stolz den Titel "Kunsttöpfermeister".
Die Töpfertradition ging zu Ende
Als er 1957 im Alter von 80 Jahren starb, zeichnete sich das Ende der Hafnerei in Hafenlohr bereits ab. Von den vielen Betrieben vor Ort – in den 1880er Jahren wurden noch sechs Betriebe gezählt - gab es Anfang der 1970er Jahre nur noch zwei: die Betriebe von Lothar Hettiger (1931-1984), einem Enkel von David Hettiger, und den von der Familie fortgeführten Betrieb von Erwin Hettiger (1914-1974). Aber es war schließlich nur noch ein Hobby. Ein Hobby ist es noch heute für Waltraud Hettiger-Imhof, eine Tochter von Erwin Hettiger, aber die lange Töpfertradition geht in unserer Zeit vor Ort zu Ende.
Ein Hobby war es schon für Karl Hettiger (1904-1968), den Sohn von David, den der Bayerische Rundfunk 1963 in seiner Werkstatt aufsuchte, und in einem Fernsehbeitrag mit dem Titel „Deutschlands älteste Töpferei“ erstmals vorstellte. Im Internet ist diese höchst interessante Sendung als BR-Retro jederzeit zugänglich.

1994 erwarb die Gemeinde Hafenlohr vorübergehend das Anwesen von David Hettiger. Das Inventar der Werkstatt kam 2001 zum großen Teil ins kreiseigene Spessart-Museum in Lohr, das sich unter Leitung von Oskar Bauer schon früh um volkstümliche Keramik und um David Hettigers Schaffen gekümmert hatte. 2002 wurde der Brennofen von Mitarbeitern des Fränkischen Freilandmuseums in Bad Windsheim abgebaut. In diesem Museum, das 2022 sein 40-jähriges Jubiläum feiern kann, wird somit eine wichtige Tradition aus Hafenlohr bewahrt. Allerdings konnte der Brennofen bisher noch nicht in die Ausstellung integriert werden.
Zum Autor: Dr. Leonhard Scherg war von 1984 bis 2008 Bürgermeister von Marktheidenfeld, er ist Kreisarchivpfleger für den Altkreis Marktheidenfeld und Rothenfels.
Literatur: Oskar Bauer, Spessarter Bauerntöpferei, in: Erich Schneider, Keramik am Untermain, Aschaffenburg 1964, S. 27-55, bes. S. 44-55; ebenda: Ernst A. Englert, Hafenlohrer Töpfertechnik, S. 56-61 und David Hettigers Lebenslauf, S. 62-68; Werner Loibl, Gibt es eine Spessarter Bauerntöpferei?, in: Weltkunst 12/1989; (Marianne Riedel), Größte Vase einst in Hafenlohr gedreht, Main-Post, 27.05.2002; Leonhard Tomczyk, Keramik im Spessart im 20. Jahrhundert, in: Frankenland 1, 2011, S. 58-73.
Unterlagen: Gemeindearchiv Hafenlohr, Sammlung Dorfgeschichte; Spessartmuseum Lohr.
Lesetipp: Den Einstieg in die Serie verpasst? Die bisher erschienenen Serienteile finden Sie unter https://www.mainpost.de/dossier/geschichte-der-region-main-spessart/
