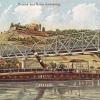Heute fahren auf dem Main Frachtschiffe mit bis zu 140 Metern Länge und 4000 Tonnen Verdrängung. Dass das möglich ist, konnten sich Mainschiffer früherer Zeiten sicher nicht vorstellen. Die längste Zeit der Mainschifferei verlief schließlich ohne jeglichen Motor. Tiere oder auch Menschen zogen einst Frachtkähne flussaufwärts und benutzten dafür die Treidelpfade.
Im heutigen Raum Main-Spessart verlief der Pfad von Kreuzwertheim bis Lengfurt rechtsmainisch – natürlich immer flussabwärts gesehen, auch wenn die Schiffe flussaufwärts gezogen wurden. Sowohl in der Haarnadelkurve am "Himmelreich" als auch in der engen Kurve von Rettersheim konnten die Leinreiter also die Schiffe in der Innenkurve schleppen. Die Treidelschiffe wurden bei der Lengfurter Fähre festgemacht. Die Pferde setzten mit der Fähre über. Dabei wurde das vordere Ende der langen Treidelleine gleich mit über den Main hinübergenommen, um dann von dort aus das Schiff hinterherzuziehen.

Bis Lohr war der Treidelpfad auf der linken Mainseite. Dann wechselte der Pfad auf die rechte – die Lohrer – Mainseite. Hier führte er vorbei an Gemünden, Wernfeld, Karlstadt und Veitshöchheim bis Würzburg. Teilweise war der Leinpfad gepflastert und das Ufer war ohne Bäume und Sträucher. Sie wären der Leine im Weg gewesen. Diese war an der Mastspitze befestigt. Der Steuermann und ein weiterer Schiffer hielten das Schiff vom Ufer ab. Dazu wurde auch der Fahrbaum benutzt, eine lange Stange mit Spitze und Haken. Flussabwärts trieben die Schiffe mit der Strömung.
Konkurrenz für die Schifffahrt durch die Eisenbahn
Dann kamen die Dampfmaschinen und Mitte des 19. Jahrhunderts die ersten Raddampfer. 1841 wurde in Würzburg die Main-Dampfschifffahrts-Gesellschaft gegründet. Wegen der fehlenden Fahrrinne, Versandungen des Flussbetts und der Konkurrenz durch die Eisenbahn wurden die Fahrten zwischen Bamberg und Schweinfurt schon 1846 eingestellt. Ab 1847 gab es nur noch Fahrten zwischen Würzburg und Mainz, aber auch Dampfschlepper, die andere Schiffe zogen. Jedoch auch der Dampfschlepp wurde 1858 wieder eingestellt.
Der Main war bei Normalwasser teilweise nur 1,20 Meter tief, bei Niedrigwasser noch flacher. Es gab noch keine Staustufen und die Strömung war stärker als heute. Dafür waren die Kettenschleppdampfer mit einem Tiefgang von nur 56 Zentimetern wie gemacht. Die Meekuh – so die Bezeichnung für einen solchen Kettenschlepper – hangelte sich flussaufwärts von Mainz beziehungsweise Aschaffenburg bis Bamberg an einer schweren Eisenkette, die auf dem Grund des Mains verlegt war. Abwärts trieb sie mit der Strömung und Turbinenantrieb. Sie selbst hatte keine Ladung an Bord, sondern zog bis zu einem Dutzend Frachtkähne hinter sich her, die damals keinen eigenen Antrieb besaßen.
1854 war die Eisenbahnstrecke von Frankfurt über Aschaffenburg und Würzburg bis Schweinfurt fertig. Die Schifffahrt verlor immer mehr Frachtanteile. Auf dem Wasser waren es von Mainz bis Lohr 197 Kilometer, auf der Schiene aber nur 113 Kilometer. 1857 gab es 784 Mainschiffe, 30 Jahre später nur noch 247. Die Kettenschlepper sollten den Verfall der Schifffahrt aufhalten.
Bayern lehnte die Kettenschifffahrt zunächst aber ab und gab der Eisenbahn den Vorzug. Nach langen Verhandlungen zwischen Bayern, Preußen und Baden kam 1892 endlich die Konzession von Aschaffenburg bis Miltenberg, die Probefahrt folgte ein Jahr später. Zuvor waren ab 1886 schon drei Dampfer im Kettenschleppbetrieb zwischen Mainz und Aschaffenburg gefahren.
Ab 1912 lag die Kette bis Bamberg
1895 begann der Betrieb bis Lohr. Der Staatseisenbahn, die zuvor der Schifffahrt so große Konkurrenz gemacht hatte, übertrug man die Gründung der Tochter "Königlich bayerische Kettenschleppschifffahrts-Gesellschaft" – daher die Buchstaben KBKS an den Seiten der Dampfer. So wurde weiterer ruinöser Wettbewerb vermieden. Sie nahm ihren Betrieb 1898 auf. Im selben Jahr ging der Abschnitt von Lohr nach Würzburg in Betrieb. Im Jahr darauf folgte die Verlängerung bis Ochsenfurt, im nächsten Jahr bis Kitzingen. Aufgrund günstiger Betriebsergebnisse bewilligte die Abgeordnetenkammer die Verlängerung der Kette bis Bamberg. 1911 war Schweinfurt angeschlossen, ein Jahr später dann auch Bamberg.

Bis 1911 stellte Bayern für die Strecke Aschaffenburg-Bamberg acht jeweils 46 Meter lange und 7,40 Meter breite Schiffe in Dienst. Gefertigt wurden sie in Übigau bei Dresden, anschließend in Einzelteile zerlegt per Bahn nach Aschaffenburg transportiert und dort zusammengebaut.
Bei der Schleppfahrt mainaufwärts wurden unterwegs immer wieder Frachtkähne abgekoppelt und andere angehängt. Die Jahre vor dem Ersten Weltkrieg waren die mit den meisten Schleppfahrten. Es gab mehr als 250 Bergfahrten pro Jahr, bei denen etwa 5000 unbeladene und etwa 2000 beladene Schiffe gezogen wurden. Talwärts wurden nur wenige Schiffe geschleppt. Die meisten trieben mit ihrer Ladung wie ein Floß mit der Strömung flussab.
Die Kette machte einen Riesenkrach
Die Abnutzung der Kette bereitete große Probleme. Innerhalb von zehn Jahren war ein Masseverlust von bis zu 30 Prozent aufgetreten. Kettenbrüche waren die Folge. Ständig wurde experimentiert. In Frankreich gab es Schiffe, bei denen die Kette über eine elektromagnetische Kettenscheibe lief. Dann entwickelte man ein Greifrad, das von beiden Seiten her unzählige Bolzen auf die Kette schob. Die Bolzen hielten wie Finger die Kette fest und gaben sie nach einem Stück Umdrehung wieder frei. Diese Technik wurde am Main lange eingesetzt.
Diese störanfälligen Greifräder begann man ab 1924 durch Zweitrommelwinden zu ersetzen. Die Kette lief über die erste zur zweiten Trommel, wieder zurück zur ersten und so weiter. Nach dreifacher Umschlingung jeder Trommel wurde sie hinter der zweiten Trommel wieder freigegeben. Das System funktionierte über Reibung. Die Kette war aus 26 Millimeter dickem Material. Und sie war laut. Ein älterer Mann aus Zell erzählte: "Die hat mer scho ghört, wenn die in Margetshöche warn. Ratatatat, so ging jedes Glied. Das hat en Mordskrach gemacht, wenn sich des hochgerasselt hat."
Vorne und hinten befanden sich Ausleger – der vordere nahm die Kette aus dem Fluss, mit dem hinteren konnte sie besonders in Flusskrümmungen wieder in der Mitte der Fahrrinne abgelegt werden. Vorne befand sich zudem ein Kran für einen Suchanker, mit dem man die Kette vom Grund auffischen konnte. Eigentlich sollte das nicht passieren, denn für den Fall eines Kettenrisses gab es den Kettenfänger, der die Kette festhielt.
Buben tauchten nach der Kette
Beim Baden holten Buben die Kette öfter aus dem Wasser. Der Zeller erzählte: "Wir haben sie hochheben können, so vier oder fünf Buben. Im Wasser war sie nit so schwer. Auf Kommando haben wir sie wieder fallen lassen. Aber wehe, einer hätt den Fuß druntergehabt." An Mainbrücken wie der in Karlstadt spielte sich jedes Mal ein besonderes Schauspiel ab. Ein alter Karlstadter: "Da hat die Meekuh immer den Schlot umgeklappt." Sie habe immer viel Qualm gemacht, vor allem, wenn kräftig eingeheizt wurde.
Bergwärts schaffte die Meekuh mit ihren 130 PS zwischen vier und sechs Kilometer in der Stunde. Bei der Talfahrt mit Turbinen waren es zwölf bis 14 Kilometer. Sieben Mann hatten einen 16-Stunden-Tag, wird von der Elbe berichtet, wobei von Dezember bis Februar Winterruhe war. Ähnlich dürfte es am Main gewesen sein. 60 bis 80 Kilometer wurden durchschnittlich am Tag zurückgelegt. Von unzähligen Unfällen ist die Rede.
Die legendäre Dampfpfeife
Ihre dumpfe Dampfpfeife gab der Meekuh ihren Namen. Der Zeller: "Bevor sie die Kurve genommen hat, hat sie immer getut, wie wenn e Kuh schreit." Polizeilich geregelt waren zehn gefährliche Mainstellen, an denen der Kettendampfer einen doppelten Pfiff abgeben musste. Die zu Tal treibenden Schiffe und Flöße hatten beizudrehen, also die Fahrt zu unterbrechen.
An weniger gefährlichen Stellen genügte ein Pfiff. Hier mussten die anderen nur ausweichen. Eine dieser Stellen war offenbar die Kurve am Karlstadter Hafen. "Immer unter der Brücke hat die Meekuh gebrummt", schildert der Karlstadter. Ein Signal gab es auch vor den Heimatorten der geschleppten Schiffer. Dann wurde die Fahrt verlangsamt und Angehörige brachten in Nachen Lebensmittel und frische Wäsche.

Die Staustufen leiteten das Ende der Meekuh ein. Bis Aschaffenburg war der Untermain 1921 kanalisiert. 1926 begann der weitere Ausbau, der die Kettenschifffahrt nach und nach überflüssig machte. Die ersten Dieselschlepper kamen auf. Die Staustufe Lengfurt wurde 1937 gebaut, Rothenfels 1937, Steinbach 1938, Harrbach 1938 bis 40, Himmelstadt 1939 bis 40, Erlabrunn 1935. Zuletzt fuhren nur noch zwei Schlepper am Obermain beziehungsweise nur noch bei Niedrigwasser.
Die letzte Meekuh verschrottet
Nach dem Bau der Staustufen wurde 1937 die Kettenschleppschifffahrt eingestellt. Im Mai 1938 wurde die Kette aus dem Wasser geholt. Die letzte Meekuh diente nach dem Krieg der Firma Väth als Wohn- und Büroschiff, lag im Würzburger Alten Hafen, später am Mainkai, war Schiffsbedarfslager, wurde 1976 repariert und renoviert. Dann diente sie als Wohnunterkunft für zwei Binnenschiffer an der Einfahrt zum Neuen Hafen Würzburg. Der Verkauf an Klaus Junghans aus Meißen erfolgte 1998. Ursprünglich wollte er das Schiff in seine Heimat bringen lassen, um es als Restaurantschiff in Dresden zu benutzen. Daraus wurde aber nichts. Irgendwann landete die Meekuh im Hochofen.
Übrigens: Das schwimmende Lokal "Mainkuh" in Würzburg ist nicht auf einem original Meekuh-Schwimmkörper von damals aufgebaut.
Quellen: Zesewitz, Düntzsch, Grötschel: Kettenschifffahrt, VEB-Verlag Berlin 1987; Otto Berninger: Kettenschleppschifffahrt auf dem Main, Wörth 1987.
Lesetipp: Den Einstieg in die Serie verpasst? Die bisher erschienenen Serienteile finden Sie unter https://www.mainpost.de/dossier/geschichte-der-region-main-spessart/