Bloß keine Schwäche zeigen, immer funktionieren und mit beiden Beinen fest im Leben stehen: Mit diesen Klischees und Rollenbildern werden besonders heranwachsende Männer häufig konfrontiert. Wer sich an solchen oft unrealistischen und veralteten Bildern orientiert, ist großem Druck ausgesetzt. Ein Druck, dem manche Männer nicht standhalten können. Die mögliche Konsequenz: Sie ziehen sich zurück, verstummen, entwickeln soziale Ängste und verfallen in Depressionen.
Markus Bauer hilft Männern, da wieder herauszukommen. Er ist seit 15 Jahren als Psychologe in der psychosomatischen Klinik des Rhön-Klinikum-Campus in Bad Neustadt tätig. Die dort eigens eingerichtete Therapiegruppe "Junge Männer" ist auf die Probleme heranwachsender Männer spezialisiert. Im Interview klärt Psychologe Markus Bauer über Rollenbilder, Therapieansätze und den Umgang mit den eigenen Gefühlen auf.
Frage: Wieso kommen die Patienten in die Therapie?
Dipl. Psych. Markus Bauer: Die Patienten haben meistens als Einweisungsdiagnose eine Depression oder soziale Angst. Unter den beiden Diagnosen kann man eigentlich auch die sozialen Probleme und die Probleme mit der eigenen Rollenidentität ganz gut subsumieren. Der Begriff "Junge Männer" ist insofern klinisch nicht einfach zu definieren, weil Mann-Sein keine Diagnose oder Krankheit ist. Andere Therapiegruppen haben immer ein diagnostisches Vorzeichen, zum Beispiel Traumatisierung. Die Gemeinsamkeit der Gruppe liegt nicht in der Krankheit, sondern im Mann-Sein. Zur Gruppe zählen erwachsene Männer. Hier liegt die Obergrenze bei 29 Jahren. Aber die ist nicht in Stein gemeißelt. In Ausnahmefällen zählen auch ältere Patienten mit dazu.
Was ist das Besondere an dieser Personengruppe?
Bauer: Männer nehmen grundsätzlich Therapieangebote seltener in Anspruch. Von den Männern, die Therapie in Anspruch nehmen, ist die Gruppe der jungen Männer diejenige, die insgesamt noch seltener Therapie in Anspruch nimmt.

Woran liegt das ihrer Meinung nach?
Bauer: Das liegt an dem traditionellen männlichen Rollenbild. Also einem Rollenbild, wie es noch in der Generation meiner Eltern vorhanden war. Da wurde erwartet, dass ein Mann stark ist, dass er die Dinge ganz allein hinkriegt, dass er autonom ist und gefühlsmäßig sehr belastbar ist. Wenn man das vorbildhaft durch seinen Vater miterlebt, dann nimmt man das auch auf. In der Rolle als Mann oder Junge will man Bestätigung, deshalb probiert man es so, wie es andere einem vorleben. Man muss dazu sagen, diese Rollenbilder sind, wie man heutzutage weiß, sehr stark milieuabhängig. Wir haben Milieus, wo es ein sehr modernes Rollenbild gibt, wo viel Platz ist für Emotionen. Wir haben aber auch Milieus, die noch sehr klassisch funktionieren, so wie früher.
Wie sieht so ein modernes Rollenbild aus?
Bauer: Wenn man jetzt von einem modernen Großstadtmilieu spricht, mit einem entsprechenden Bildungshintergrund und Vermögen – da ist das ganz normal, dass Väter den Kinderwagen schieben. Dass sie mit den Kindern auf den Spielplatz gehen. Ein zärtliches und inniges Verhältnis zu Kleinkindern haben. Dieses neue Verständnis ist offener für Neues als das klassische, konservative Bild.

Also wandelt sich das Rollenverständnis von Männern aktuell?
Bauer: Auf der einen Seite nimmt die Toleranz für alternative Lebensentwürfe zu. Auf der anderen Seite kann das aber wieder in die Überforderung führen, wenn sie ins Internet schauen, was da vorgelebt wird. Allein was das Äußere angeht. Wie soll ein Mann aussehen? Das sind ja Supermänner, die Sie da in den Clips sehen. Da werden solche unerreichbaren und unrealistischen Vorbilder vorgelebt, dass ich natürlich voll verstehen kann, dass junge Menschen wackelig werden, was ihre eigene Identität angeht, wenn das der Maßstab ist. Ich finde, es ist nicht leichter geworden. Die Schwierigkeiten und Möglichkeiten haben sich verändert, aber ich glaube, es ist immer noch eine ganz schöne Herausforderung, Mann zu werden.
Mit welchen Herausforderungen werden Männer konfrontiert, die sich an einem alten Rollenverständnis orientieren?
Bauer: Männer, die sich am alten Rollenbild orientieren, weisen folgende Eigenschaften auf: Sie denken, sie müssen Stärke, Beharrlichkeit, Selbständigkeit und eine gewisse Form von Stoizismus zeigen. In der Therapie ist es wichtig, das weiterzuentwickeln. Es geht darum, nicht nur Stärke, sondern auch Verletzlichkeit zu zeigen. Es geht nicht darum, beharrlich alles auszuhalten, sondern auch Misserfolge zu akzeptieren. Selbständigkeit ja – aber man muss auch in der Lage sein, sich Hilfe zu suchen. Der männliche Stoizismus ist gleichzeitig auch eine Blockade für den Gefühlsausdruck, der in der Therapie ganz zentral ist. Letztendlich geht es darum, nicht immer nur zu handeln, sondern auch mal zu reden. Das sind alles Einseitigkeiten, mit denen die Männer zu uns in die Therapie kommen.
Also ist es zentral, dass sich junge Männer öffnen?
Bauer: Die Stummheit, die da ist, ein Stück weit aufzutauen – das ist die größte Aufgabe in der Therapie. Also die jungen Männer überhaupt erst einmal zum Reden zu bringen. Die sitzen nämlich in der Regel in unserer Therapiegruppe so da, als wären sie in einem Verhör bei der Polizei. Sie versuchen möglichst erstmal dem Blickkontakt aus dem Weg zu gehen. Sagen nichts. Wenn sie was sagen, sind das ganz allgemeine Dinge. Nur kurze Floskeln, mit denen man nichts anfangen kann. Dieses stumm sein, nicht reden, müssen die Patienten überwinden.
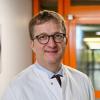
Wie kann man sich so eine Therapiegruppe vorstellen?
Bauer: Die Gruppe hat maximal 9 Teilnehmer. Es ist der klassische Stuhlkreis. Der Ansatz der Analyse und Tiefenpsychologie ist: Jetzt wird gesprochen, über das, was mir durch den Kopf geht, was ich fühle. Es werden von uns keine Themen vorgegeben oder Module abgearbeitet. Das, was spontan kommt, ist das Wertvolle.
Warum das Setting in einer Gruppe?
Bauer: Der Vorteil ist: Wenn die Teilnehmer zum Beispiel in einer Therapie im Einzelsetting sind, dann bekommen sie von einem Therapeuten eine Rückmeldung als Fachmann, aber sie erfahren überhaupt nichts über die Privatperson. Also was ich für ein Mensch bin, was ich so tue, was meine Vorlieben sind. Durch die therapeutische Abstinenz bin ich neutralisiert. Wenn sie in einer Gruppentherapie sitzen, dann sitzen idealerweise, wenn sie sprechen, acht andere Personen mit dabei, von denen jeder etwas Unterschiedliches denkt und fühlt. Irgendwo ist immer etwas dabei, was einem helfen wird. Das heißt, man bekommt wesentlich mehr Feedback, und im Unterschied zum therapeutischen Einzelsetting erlebt man die anderen in ihrer Ganzheitlichkeit. Als ganze Menschen. Mit ihren Gefühlen, mit ihren Vorlieben, mit ihren Abneigungen. Das bekommt man in einem Zweier-Setting nicht hin.
Was können Sie jungen Männern mitgeben, die sich selbst in einer Krise befinden?
Bauer: Die meisten bekommen bei sich selbst mit, dass etwas schiefläuft. Sie merken, dass sie nur mit Bauchschmerzen in die Arbeit gehen. Sie merken, dass sie nach der Arbeit oder nach der Schule wahnsinnig lange vorm Rechner sitzen. Also aus den realen, authentischen sozialen Bezügen rausgehen. Sie bekommen mit, dass die meisten Gleichaltrigen ein ganz anderes Leben führen, Geld verdienen, in den Urlaub fahren oder Partnerschaften haben, die immer fester werden. In der Regel bekommt man mit, dass etwas nicht stimmt. So weit weg ist das gar nicht. Der springende Punkt ist, ob ich das irgendwann mal ernst nehme und sage: Ich muss jetzt etwas machen! Ich stehe das nicht mehr durch! Und dann ist natürlich der Weg immer der beste, jemanden zu fragen, der Ahnung hat. Also sich an einen Fachmann, eine Fachfrau zu wenden. In der Regel ist das der Hausarzt.
