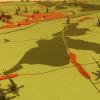Der Wind steht still, an diesem Wintertag. Fast senkrecht steigt ein großer, weißer Pilz über der Stadt auf. Die Dampfwolke eines Schornsteins weckt makabre Assoziationen auf dem Weg zum "Deutschen Bunkermuseum". Im Hochbunker aus dem Zweiten Weltkrieg wurde die Ausstellung mittlerweile erweitert – zu besichtigen in der Zeit nach dem Lockdown. Zusätzlich zu Exponaten rund um den Luftschutz wird es dann Eindrücke aus dem Kalten Krieg geben, als der "A8" Atomschutzbunker war.
Zwischen Rhön und Saale erstreckte sich damals der "Fulda Gap", eine strategische Lücke am Eisernen Vorhang, durch die Panzertruppen des Warschauer Pakts hätten vorstoßen können. Wäre Schweinfurt ein lohnendes Ziel für einen Atomschlag gewesen? Nils Brennecke verweist auf den Brönnhof: "Dort befand sich der drittgrößte US-Übungsplatz in Europa." Der Leiter des Bunkermuseums stammt selbst aus dem südhessischen Birstein.

Im apokalyptischen Paralleluniversum des Dritten Weltkriegs wäre dem Raum Schweinfurt außerdem noch ein Anteil am "Zebra-Paket" zugedacht gewesen: Mit 141 taktischen Kernsprengköpfen hätte der feindliche Ansturm zum Stillstand gebracht werden sollen, in der Fuldaer Bresche, deponiert vor allem an Brücken oder Schnellstraßen. Gemeinden wie Niederwerrn oder Euerbach dürften davon profitiert haben, dass den Genossen die Pläne eines "nuklearen Sperrfeuers" frühzeitig bekannt waren. Im Museum hängt eine Stasi-Meldung vom Januar 1965 mit dem Foto einer US-Panzerkolonne, die durch die Niederwerrner Straße rollt. "Marne Might" nannte sich das Atomkriegsmanöver in Unterfranken.

"Schweinfurt hat Schwein" steht auf einer Kaffeetasse in der "Fernmeldezentrale des Krisenstabs", wie sie sich seinerzeit im Landratsamt befand, unter dem Porträt von Bundespräsident Karl Carstens. Auf Meldevordrucken sollte im V-Fall akribisch festgehalten werden, was an der Heimatfront gerade los war: Bombenangriffe und Art des Kampfstoffes? Anzahl der Geschosse oder Flugzeuge? Knallzeit? Breite der Detonationswolke nach fünf Minuten? Geschätzter Detonationswert in Kilotonnen? Kontamination (nuklear, biologisch, chemisch)?

Mit Zivilschutz-Helm und ABC-Schutzmaske in Griffweite konnte der Telefonist wahlweise Bundeswehr, THW, Feuerwehr, Polizei oder Friedhof erreichen, dank Steckverbindungen. Nach dem Telefonieren hieß es "Abläuten nicht vergessen", sprich nochmals kurbeln, wegen der Überspannungs-Gefahr. Zum Glück ist diese Art von Spannungsfall längst Geschichte. Ein Raum widmet sich den Katastrophenschutzzügen des BRK, dem die Zivilverteidigung im Landkreis oblag. Entstanden ist er in Kooperation mit Ehrenkreisbereitschaftsleiter Friedel Tellert.

2014 haben Nils und Petra Brennecke den Oberndorfer Hochbunker erworben, einer von ehemals 13 der Stadt, im Volksmund "Fichtel- & Sachs-Bunker" genannt. Eigentlich sollte auf dem Betonpodest mal ein Penthouse entstehen. Daraus wurde ein ehrenamtlich betriebenes Museum mit der größten Sammlung von Ausstellungsstücken zu Luftkrieg und Atomschutz in Deutschland. 1983 war der Weltkriegsklotz reaktiviert worden, ein Luftfilter aus 120 Tonnen Sand schützte mehr oder weniger vor radioaktiven, biologischen oder chemischen Gefahren. Bizarr muten die rotblauen "Jogginganzüge" an, die die Bunkerinsassen hätten tragen sollen, nach dem Tag des nuklearen Höllenfeuers. Für die Kinder hingen Trinkfläschchen bereit, mit Märchenmotiv. Nebst Lebensmitteln wurde damals schon Klopapier gehortet. Eine autarke Wasser- oder Stromversorgung war hinter den Stahltüren gar nicht erst vorgesehen.

Als Zeitsoldat a.D. weiß Brennecke, welche Verwüstung selbst konventionelle Waffen anrichten. In den 90er-Jahren war er als Rundfunkmoderator im zerschossenen Bosnien und Kroatien für den Bundeswehr-Sender Radio Andernach unterwegs. "Das war wie im Film 'Good Morning, Vietnam'", sagt der Schweinfurter und meint den absurden Wahnsinn des Krieges, wie ihn Robin Williams als Militär-DJ Adrian Cronauer anprangert. Die Vergangenheit begreifbar machen: Darum geht es in den beklemmenden Räumen, in denen sich original Schweinfurter Ziegelsteine aus der Weltkriegszeit neben kleingefetzten Kampfflugzeugen, Geschossresten, Erste-Hilfe- oder Alltags-Utensilien finden.

Selbst der Anstifter des Weltenbrands ist indirekt vertreten, mit Betonbrocken und Tarnnetz-Resten aus dem Führerhauptquartier Wolfsschanze in Ostpreußen. "Gardine gemiedlich" – an diese Parole der Gästeführerin kann sich Brennecke gut erinnern bei einer Exkursion ins heutige Polen. In Hitlers fensterloser Bunkerwelt ("entstanden aus Angst") sollten Gardinen kleinbürgerliche Gemütlichkeit vorgaukeln. Am 20. Juli 1944 sprengte Oberst von Stauffenberg die Besprechungs-Barracke des Völkermörders in die Luft. Nils Brennecke hat Bruchstücke des Fundaments mitgenommen. All das Grauen ist wirklich passiert, nicht nur in Schweinfurt, wurde erst geplant und dann systematisch in die Tat umgesetzt – davon künden die braungrauen Steine in ihrer Vitrine.

Ach ja, Corona. "Wir japsen aus dem letzten Loch", berichtet Brennecke, "ein Jahr lang hatten wir nahezu keine Einnahmen, keine Hilfe bis jetzt." Auf Facebook, Youtube und der Internetseite (www.deutsches-bunkermuseum.de) zeigt das Museum weiterhin Präsenz. "Es ist ein Zuschussbetrieb aus der eigenen Tasche. Weil Petra und ich das als unsere Berufung sehen: die Arbeit gegen das Vergessen." Zumindest Bernie Sanders hat im Januar vorbeigeschaut, der Linksaußen unter den US-Präsidentschaftsaspiranten. Das Internet-Meme mit "Opa Bernie" gibt es längst auch als Foto vor dem Bunker A8.