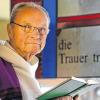Der Schweinfurter Pfarrer Roland Breitenbach ist bekannt als streitbarer Geist, dabei wird oft aus dem Blick verloren, dass er in erster Linie Seelsorger ist. Im Rahmen seines seelsorglichen Wirkens begleitet er Sterbende und weiß, dass diese eine eigene Sprache entwickeln.
Frage: Herr Breitenbach, wie kommen Sie auf die Idee, dass Sterbende eine eigene Sprache haben?
Roland Breitenbach: Aus Erfahrung. Als ich vor 50 Jahren als Kaplan in Bad Kissingen von Klink zu Klinik herumgeeilt bin, wusste ich das auch noch nicht. Ich musste diese Sprache erst lernen. Heute weiß ich, dass nicht nur Schwerstkranke und Sterbende, sondern auch kerngesunde Menschen eine eigene Sensibilität entwickeln für das, was kommt. Die Angehörigen müssen nur hellhörig für die Zeichen werden und sie zulassen. Das erfordert ein hohes Maß an Achtsamkeit.
Eine Achtsamkeit, die wir im normalen Umgang miteinander nicht haben?
Breitenbach: Zumindest selten, wir sehen oft nur die Maske, die ein Mensch trägt und die auch Sterbende manchmal noch aufhaben. Aber hinter dieser Maske ist oft ein einsamer, hilfesuchender Mensch. Den gilt es wahrzunehmen. Das, was der Sterbende wirklich will und braucht, ist oft nur in seinen Augen zu lesen.
Und was kann man da lesen?
Breitenbach: Nun, zuallererst die Bitte: Schieb mich nicht ab, lass mich nicht allein. Sprich mit mir: Ich höre länger und spüre tiefer deine Gegenwart, als es von außen aussieht. Eine meine ersten Erfahrungen im Krankenhaus war, dass ich zu einem Sterbenden gerufen wurde, von dem der Arzt behauptete, er reagiere auf nichts mehr. Ich nahm seine Hand, habe mit ihm geredet und der Puls ging nach oben. Ein andermal besuchte ich eine Schlaganfallpatientin, von der der Assistenzarzt behauptete, sie sei nicht mehr ansprechbar. Nun, meine Erfahrung war älter als der Arzt, ich habe ihr Lieblingskirchenlied gesungen und bei der zweiten Strophe sang sie plötzlich mit. Auch das ist eine Bitte der Sterbenden: Bete, singe, sprich mit mir über das, was ich liebe, was mir etwas bedeutet.
Das heißt der Sterbende reagiert durchaus, auch wenn wir es rein äußerlich nicht wahrnehmen?
Breitenbach: Ja, vor allem hören sterbende Menschen sehr gut. Ich habe schon Angehörige aus dem Krankenzimmer verwiesen, weil sie begonnen haben, im Beisein des Schwerstkranken übers Erbe zu streiten.
Welche Eigenschaften braucht denn jemand, der einen Sterbenden begleiten will?
Breitenbach: Neben der Achtsamkeit und einer guten Portion Einfühlungsvermögen braucht es vor allem Geduld und Gelassenheit. Die Prozesse in der Sterbephase verlangsamen sich deutlich. Außerdem schwindet oft schon früh die Fähigkeit zu sprechen, so dass man sich durch behutsames Fragen zu dem vortasten muss, was der Sterbende sich wünscht. Auch dürfen manche Aussagen nicht so sehr wörtlich genommen werden, man muss den Sinn dahinter erst finden. Wenn ein Patient zum Luftballon, den ihm sein Enkel mitgebracht hat, sagt: „Dem geht auch die bald die Luft aus“, dann hat das eben nur bedingt mit dem Ballon zu tun. Oder wenn ein Zwölfjähriger auf dem Sterbebett seine längst verstorbene Mutter sieht und sagt: „Meine Mama holt mich jetzt ab“, dann sollten wir solche Erfahrungen nicht ad absurdum führen, sondern darauf eingehen und beispielsweise fragen: „Was hat deine Mama denn gesagt?“
Aber die Angehörigen müssen auch bereit sein, den Sterbenden loszulassen, dazu ist ein ehrliches Miteinander nötig. Menschen spüren, wann die Zeit gekommen ist zu gehen und ich muss ihnen nicht sagen: „Das wird schon wieder.“ Das bedeutet, den Sterbenden nicht ernst zu nehmen.
Sie haben schon viele Menschen in ihren letzten Stunden begleitet. Belastet das einen nicht auch selbst sehr?
Breitenbach: Es gibt immer auch lustige Ereignisse am Kranken- und sogar am Sterbebett. Vor allem mit Menschen, die auch in ihrem Leben gerne gelacht haben. Einmal habe ich mit einem 18-jährigen Leukämiepatienten seine Todesanzeige entworfen, das war sehr lustig, bis die Anzeige fertig war. Es begann mit „Mein innigster geliebter Sohn“ und dem Lachen darüber, dass die Mutter das nie in der Todesanzeige schreiben würde, bis zum Schluss: „Auch wenn mich meine Mutter nie so lieben konnte, weil ich so störrisch war, bin ich dankbar für die Zeit, die ich mit ihr leben konnte.“
Sie haben im Umgang mit Sterbenden schon vieles erlebt. Gibt es eigentlich auch etwas, was sie dabei noch nicht erlebt haben?
Breitenbach: Eindeutig ja. Ich habe es noch nie erlebt, dass ein Sterbender gesagt hat, dass er in aller Stille begraben werden will. Jemanden in aller Einsamkeit verscharren, das ist eher der Wunsch der Angehörigen, die den Tod nicht ertragen können. Auch anonyme Bestattung halte ich für problematisch.Wir Menschen brauchen einen Ort der Erinnerung. Mich hat einmal die Mutter eines Drogenabhängigen angerufen, ich solle ihren Sohn irgendwo beerdigen. Sie wollte damit nichts mehr zu tun haben, sie hatte die letzten Jahre genug unter dem Sohn gelitten. Nun, die Mutter hat sich dennoch auf einen kleinen, festen Platz zur Bestattung eingelassen. Bei der Beerdigung war sie nicht, nur andere Drogenabhängige, aber später hat sie sich bei mir für den festen Platz bedankt. „Ich gehe täglich zum Grab meines Sohnes und mit jedem Tag wird es mir leichter, weil ich mich versöhnen kann“, erzählte sie mir.
Wenn man ständig über den Zaun schaut, andere beim Sterben begleitet, bekommt man dann nicht auch eine besondere Einstellung zum eigenen Tod?
Breitenbach: Wer Sterbende begleitet, bekommt etwas geschenkt, nämlich Gelassenheit und Hoffnung. Dafür bin ich dankbar. Deswegen muss das eigene Sterben nicht gerade leichter werden, aber die Angst vor dem Tod wird genommen. Ich halte es da mit einem Wort der deutsch-jüdischen Lyrikerin Mascha Kaleko: „Vor meinem eignen Tod ist mir nicht bang, nur vor dem Tode derer, die mir nah sind.“