Die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns (KVB) spricht schon von "drohendem Praxenkollaps": Die Vergütung durch die Krankenkassen sei angesichts von Inflation, teurer Energie und Personalmangel völlig unzureichend. Doch nicht nur wirtschaftliche Aspekte bringen die niedergelassenen Ärzte immer stärker in Bedrängnis. In vielen Bereichen fehlen Nachfolger.
Was läuft schief im Gesundheitssystem? Was müsste sich im Praxisalltag ändern? Drei niedergelassene Mediziner aus Unterfranken geben Einblicke in ihre Arbeit und nehmen Stellung.
1. Dr. Gunther Carl, Neurologe und Psychiater in Kitzingen: "Die Bürokratie ist abschreckend"
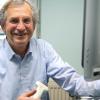
Was schief läuft im System: Für Gunther Carl steht der Patient im Mittelpunkt. Ihn nervt deshalb, wenn er in seiner Praxis immer mehr Zeit für Dokumentation und Verwaltung aufbringen muss. Schon vor Jahren hat er ein Patientenzimmer in ein Verwaltungsbüro mit drei Arbeitsplätzen umfunktioniert.
"Wir brauchen Formulare in DIN A6 quer und längs, in A5 quer und längs, in A4 und in A5 noch extra auf rosa Papier, das nur bei einem bestimmten Hersteller bezogen werden darf – für die Krankschreibung", sagt der 67-Jährige mit Galgenhumor. Die Bürokratie habe überhand genommen. Bei einer durchschnittlichen Wochenarbeitszeit von 52 Stunden verbringe ein niedergelassener Arzt heute laut Kassenärztlicher Bundesvereinigung allein 7,5 Stunden nur mit Verwaltung: "Das ist abschreckend für junge Ärzte."

Abrechnungen, Anträge, Korrespondenz mit Kassen, Ärztekammer oder KV – "alles ist viel kleinteiliger und komplexer geworden". Die Digitalisierung könnte helfen, meint der erfahrene Neurologe. Doch sie werde stümperhaft vorangetrieben. "Fehlerbehaftet, unausgereift und zeitraubend" sei die vom Ministerium verordnete Telematik-Infrastruktur. "Das E-Rezept nutzt dem Arzt gar nichts", sagt der Kitzinger. Im Gegenteil – das Ausstellen dauere wegen der digitalen Signatur deutlich länger.
Hinzu komme eine veränderte Anspruchshaltung: Auch mit kleineren Beschwerden würden Patientinnen und Patienten zum Facharzt kommen – "man erwartet dann die vollumfängliche Abklärung mit allen Untersuchungen und stellt das eigene Anliegen als besonders dringlich dar". Die Idee einer Eigenbeteiligung als Steuerungsinstrument bei Arztbesuchen kann der Neurologe deshalb nachvollziehen.
Was sich ändern müsste: Zentrale Forderung des Kitzinger Facharztes ist der Abbau von Bürokratie mit weniger Dokumentations- und Kontrollpflichten. Die Zeit könne besser für Patienten und mehr Termine genutzt werden. Carl ist für eine Digitalisierung in den Praxen – aber "mit einem Update auf das heute technisch Mögliche". Man sei "auf dem Stand vor 15 Jahren, weil so lange darüber verhandelt wurde".

Dritter Wunsch des Neurologen: Entbudgetierung bei den Honoraren. Ärzte sollten von den Kassen alle erbrachten Leistungen auch erstattet bekommen, sagt Carl. Für Fachärzte liege die Auszahlungsquote derzeit bei 85 Prozent. Auf dem Rest würden sie sitzen bleiben – "weil nicht genug Geld von den Kassen da ist". Diese Unsicherheit mache einen Praxisbetrieb wirtschaftlich schwer kalkulierbar.
2. Dr. Elisabeth Rieck, Hausärztin in Neubrunn: "Weg mit dem Privatpatiententum"

Was schief läuft im System: Elisabeth Rieck ist Hausärztin mit Leib und Seele. Sie versucht sich Zeit zu nehmen für ihre Patientinnen und Patienten. Das Problem: Ein Gespräch oder eine körperliche Untersuchung wird von den Privatkassen deutlich schlechter honoriert als der Einsatz von Apparaten wie Ultraschall oder Computertomografie. Was dazu führe, dass vor allem bei Privatversicherten "viele, teils unnötige Untersuchungen" gemacht werden – Stichwort Überdiagnostik.
Die Abrechnungsordnung für Privatpatienten stamme zum Großteil von 1982, sagt Rieck. Damals galten Medizingeräte als sehr teuer, entsprechend hoch waren die Gebührenumlagen. Inzwischen seien die Kosten vieler Geräte wie EKG oder Pulsoxymeter deutlich gesunken. Eine wirkliche Anpassung der Vergütung sei aber ausgeblieben, stellt die Hausärztin fest: "Es lohnt sich also finanziell, bei Privatversicherten viel Diagnostik und wiederkehrende Kontrollen zu betreiben."

Bei Kassenversicherten behandle man in der Regel leitlinienorientiert. Es gelte, durch das Überweisungssystem eine Unterversorgung oder Überdiagnostik zu vermeiden. Der Schwerpunkt liege auf den Beratungsgesprächen und der klassischen körperlichen Untersuchung, sagt die Hausärztin. "Ergebnis: Kassenpatienten fühlen sich scheinbar benachteiligt."
Deshalb würden viele immer nachdrücklicher und teils ungeduldig Untersuchungen "oder ein großes Blutbild" fordern. Oder würden selbstständig Termine beim Facharzt ausmachen, "der dann mal alles checken soll". Dies führe zu einer weiteren Verknappung der Termine, sagt Rieck. Hauptleidtragende seien dann chronisch Erkrankte und wirklich behandlungsbedürftige Menschen.

Die Versorgung und Begleitung ihrer Patienten erfordere Zeit, Kommunikation, viele Absprachen mit anderen Ärzten. "Diese Mehrarbeit ist meist unbequem und wird auf Ärzteseite nicht adäquat honoriert", meint die Neubrunner Hausärztin. Sie habe von Facharztpraxen gehört, die einer akut erkrankten Patientin einen "Kassentermin" in vier Wochen angeboten hätten – oder für 50 Euro sofort in der "Privatsprechstunde" noch am selben oder nächsten Tag. "Daran erkennt man, wie krank das System geworden ist."
Es gehe nicht mehr um den Leidensdruck der Patientinnen und Patienten. "Nicht nur Angebot und Nachfrage, sondern Geld reguliert nun auch die Arzttermine. Das macht mich betroffen."
Was sich ändern müsste: Elisabeth Rieck wünscht sich mehr Wertschätzung für die Hausarztpraxis – "nicht nur in Worten, sondern auch in Taten" von Politik, Ämtern und Kliniken. Viel zu oft würden Patienten unvorbereitet und überstürzt entlassen. "Ein kollegiales Gespräch im Vorfeld könnte hier viel Ärger ersparen."

Rieck diagnostiziert eine "Drei-Klassen-Medizin" mit Privatpatienten sowie Kassenpatienten in der Stadt und auf dem Land. Ihre Therapie dagegen: Abschaffung des Privatpatiententums. Rieck fordert ein Primärarztsystem, in dem Hausarzt oder Hausärztin als erste Anlaufstellen die Versorgung aller sichern – und so ihre Patienten vor zu viel wie zu wenig Medizin schützen können.
3. Dr. Max Zellner, Hals-Nasen-Ohren-Arzt in Ochsenfurt: "Vom Bundesgesundheitsminister diskreditiert"

Was schief läuft im System: Max Zellner hat in seinen 25 Jahren mit eigener HNO-Praxis einiges an Veränderung erlebt. Gerade sei die Zahl der Patienten deutlich angestiegen, weil andere Facharztpraxen teilweise keine Neupatienten mehr aufnehmen würden oder eine Praxis mangels Nachfolger schließe.
"Dadurch entsteht eine Migration in die verbliebenen, noch aufnahmewilligen Praxen, was zu längeren Wartezeiten bei den Terminen und in der Praxis führt", sagt Zellner. Wegen des Andrangs besetze er Termine zum Teil doppelt. Wird ein Terminwunsch nicht erfüllt, reagierten viele Patienten mit Unverständnis, gelegentlich beleidigend gegenüber den Mitarbeiterinnen.

Zellner operiert als Belegarzt an der Main-Klinik in Ochsenfurt. Wenn er einen Eingriff aus Kapazitätsgründen nicht durchführen könne, schaffe er es aktuell kaum, seine Patienten in der Würzburger Uniklinik oder anderswo unterzubringen.
Auch Max Zellner klagt über eine "deutliche Zunahme der Bürokratie" durch die Ausweitung von Dokumentationspflichten bei Datenschutz oder Hygiene oder durch die Einführung der elektronischen Patientenkarte. Damit verbunden seien ständige kostspielige IT-Erweiterungen, in die sich die Angestellten erst einarbeiten müssen.

Verschärft werde die Situation durch den Personalmangel bei den Medizinischen Fachangestellten, sagt der Arzt. Auch wenn er selbst aktuell alle Stellen besetzt hat: "In der Vergangenheit mussten wir immer wieder Sprechstunden streichen, da nicht genug Mitarbeiterinnen da waren." Und wie andere Niedergelassene beobachtet auch Zellner den Trend, dass Patienten mit Beschwerden direkt zum Facharzt kommen, obwohl der Hausarzt sie behandeln könne.
Die Folge all der schwierigen Umstände sei, dass junge Kolleginnen und Kollegen "nicht mehr in die Niederlassung streben, sondern lieber in der Klinik bleiben".
Was sich ändern müsste: Um den Betrieb einer Praxis wieder attraktiver und Patienten zufriedener zu machen, wünscht sich der HNO-Spezialist mehr Freiheit durch die Kassen. Er fordert eine Streichung der "WANZ"-Kriterien (wirtschaftlich, ausreichend, notwendig, zweckmäßig), die das Wirtschaftlichkeitsgebot bei Behandlungen beschreiben. Zellner findet: "Der Patient sollte das erhalten, was er benötigt und nicht, was Rabattverträge vorgeben."
Auch Regressandrohungen sollten fallen: Ist der Arzt von einer medizinischen Maßnahme überzeugt, die Kasse aber nicht, bleibt die Praxis derzeit leicht auf ihren Kosten sitzen, sagt Zellner. Er mahnt ein Ende der Budgetierung und der Begrenzung von Fallzahlen wie zuletzt bei den Kinderärzten an: "'Alle erbrachten ärztlichen Leistungen sollten von den Kassen voll bezahlt werden."

Neben diesen wirtschaftlichen Faktoren wünscht sich Max Zellner mehr Wertschätzung für die Fachärzte. Sie würden vom Bundesgesundheitsminister als unnötige "doppelte Facharztschiene" neben den Kliniken diskreditiert.
