US-Präsident Joe Biden hat Mitte September das Ende der Pandemie verkündet, in Deutschland sind Politik und Wissenschaft zurückhaltender. Denn sicher ist: Verschwinden wird das Virus nicht mehr und es tauchen immer wieder neue Varianten auf. Wie also kann ein normales Leben auch mit Corona aussehen und gelingen?
"Corona ist erst dann vorbei, wenn wir einen Winter ohne Kontaktbeschränkungen durchgekommen sind", sagt Prof. Lars Dölken. Der Leiter des Instituts für Virologie und Immunbiologie an der Uni Würzburg sieht zwei mögliche Zukunftsszenarien für Sars-CoV-2. Ein Gespräch über die Gefahr einer "Killervariante" und die Frage, wann die Isolationspflicht fallen kann.
Herr Prof. Dölken, ist die Pandemie überall vorbei - außer in Deutschland?
Prof. Lars Dölken: Nein, das kann man so nicht sagen. Man muss sich aber über den Begriff "Pandemie" klar werden: Unter Pandemie versteht man die schnelle Ausbreitung einer Infektionskrankheit über Grenzen und Kontinente hinweg, also eine globale Bedrohung. In diesem Sinne, als alles überschattende Bedrohung, ist die Corona-Pandemie sicherlich vorbei und das Risiko erneuter Lockdowns ist weltweit massiv gesunken.
Das klingt nach einem "Aber"?
Dölken: Wir haben jetzt leider neben dem Influenzavirus ein zweites Virus, das jeden Einzelnen von uns bei zwischenmenschlichen Kontakten bedroht, da es relativ schwere Erkrankungen verursachen kann. Zudem ist das Risiko für Folgeschäden wie Long-Covid noch schlecht einschätzbar. Damit ist die Situation für den Einzelnen nicht unbedingt leichter geworden.
Welche Kriterien müssen aus medizinisch-virologischer Sicht erfüllt sein, um die Corona-Krise für beendet zu erklären?
Dölken: Grundsätzlich gibt es dazu zwei Szenarien. Das erste basiert auf der Entwicklung der vier endemischen Coronaviren, die bereits vor Sars-CoV-2 vorhanden waren, und die hauptsächlich banale Schnupfen- und Erkältungssymptome auslösen. Auch diese Coronaviren sind irgendwann aus dem Tierreich auf die menschliche Bevölkerung übergegangen und wir haben uns damit arrangiert. Sie verursachen keine größeren Probleme mehr. Wie lange das gedauert hat, wissen wir nicht. Spätestens jedoch, wenn die heutigen Kleinkinder, die jetzt im jüngsten Alter schon Corona hatten, über 70 sind, haben wir wohl die gleiche Situation.
Das dauert ja noch ziemlich lange.
Dölken: So lange müssen wir natürlich nicht warten. Wir sehen ja aktuell schon eine viel bessere Situation als zu Beginn der Pandemie. Die Lage wird sich aller Voraussicht nach über die nächsten Jahre mit zunehmender Immunität in der Bevölkerung weiterhin kontinuierlich verbessern.

Und wie sieht das zweite Szenario aus?
Dölken: Das würde bedeuten, dass Sars-CoV-2 uns wie das Influenzavirus begleitet. Dass es weiterhin Sommer- und Winterwellen gibt, man sich immer wieder anstecken kann und durchaus auch schwerer erkrankt. Bei diesem Szenario wird die Immunität ebenfalls steigen, es wird aber vermutlich weiterhin Menschen geben, die sich infizieren und sagen: So krank war ich noch nie in meinem Leben.
Muss man sich das zukünftige Leben mit Sars-CoV-2 quasi wie mit den übrigen Erkältungsviren vorstellen: Sie sind überall, man wird stetig damit konfrontiert? Und mal ist das Immunsystem stark genug, um die Viren abzuwehren - mal ist es geschwächt und man erkrankt?
Dölken: Genau. Die Frage ist nur: Wie krank werden die Infizierten im Schnitt? Influenzaviren verursachen deutlich häufiger schwere Erkrankungen als zum Beispiel Rhinoviren. Unklar ist aktuell, wo sich Sars-CoV-2 einordnen wird. Am Anfang war Corona eine lebensbedrohliche Erkrankung, heute ist es nur noch eine stark belastende Infektion. Wenn man irgendwann sagen kann, eine Sars-CoV-2-Infektion ist nicht schlimmer als die meisten anderen grippalen Infekte – dann wäre sehr viel erreicht.

Gibt es Anhaltspunkte, welches der beiden Szenarien wahrscheinlicher ist?
Dölken: Coronaviren haben sich bisher nicht wie Influenzaviren verhalten. Deshalb denke ich, die Chancen stehen ganz gut, dass sich auch Sars-CoV-2 anders als Influenzaviren und mehr wie die vier endemischen Coronaviren entwickeln wird. Aber das ist aktuell ein Blick in die Glaskugel.
Warum verändern sich Viren überhaupt? Verhält sich Sars-CoV-2 wie alle anderen Viren oder hat es Sie überrascht?
Dölken: Generell besteht für respiratorische Viren ein Evolutionsdruck hin zu leichterer Übertragbarkeit von einer Person zur nächsten. Das heißt, es ist für diese Viren sinnvoller, sich im oberen Atemtrakt zu vermehren als tief in der Lunge, wo sie nur schlecht wieder rauskommen, aber deutlich mehr Schaden anrichten. Der Druck geht also hin zu leichteren Infektionen mit Schnupfen, Husten und Halsschmerzen. Sars-CoV-2 besitzt jedoch ein paar Dutzend virale Proteine. Jedes einzelne davon kann sich weiterentwickeln und besser an den Menschen anpassen – und auch auf diesem Weg die Vermehrungschancen des Virus verbessern. Das ist sicherlich in den letzten drei Jahren passiert. Wir sehen aber jetzt für Omikron auch erstmals, dass sich das Virus dahin entwickelt, mildere Erkrankungen auszulösen.
Die Gefahr einer "Killervariante", vor der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) im Frühjahr gewarnt hat, sehen Sie also nicht?
Dölken: Ich halte eine "Killervariante" für ziemlich unwahrscheinlich. Natürlich könnte diesen Winter noch mal eine etwas gefährlichere Variante aufkommen. Wir haben aber nach den beiden Omikron-Wellen eine viel größere Immunität in der Bevölkerung. Blickt man weiter in die Zukunft, dann ist es wahrscheinlicher, dass harmlosere Varianten entstehen und mit zunehmender Immunität der Bevölkerung das Problem kleiner wird.

In Summe, ist da das Coronavirus gefährlicher als das Grippevirus?
Dölken: Ja. Nach meiner persönlichen Einschätzung war Sars-CoV-2 zu Beginn der Pandemie ungefähr 20 Mal gefährlicher als Influenza. Das lag natürlich auch an der komplett fehlenden Immunität gegen das Virus in der Bevölkerung. Wir haben jedoch durch die Impfungen und die hohen Infektionszahlen mit Omikron erheblichen Schutz gewonnen. Zudem hat sich mit der Omikron-Variante die Gefahr eines sehr schweren oder sogar tödlichen Verlaufs deutlich verringert. Aktuell würde ich sagen, die akute Gefährlichkeit des Coronavirus für den Einzelnen ist nicht mehr weit von der des Influenzavirus entfernt.
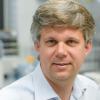
Was ist mit den Langzeitfolgen, mit Long-Covid?
Dölken: Das ist ein Punkt der schwer einzuschätzen ist. Würde ich als Erwachsener mit 40 Jahren erstmals Influenza bekommen, würde "Long-Influenza" wahrscheinlich mit der gleichen Wahrscheinlichkeit auftreten wie bei Corona. Aber diese Situation gibt es nicht, jeder hatte bis zum 30. Lebensjahr schon zig Mal die Grippe. Langfristig wird also das Problem Long-Covid wohl abnehmen. Momentan aber gibt es noch viele offene Fragen.
Vor Corona war wohl noch keine Krankheit so lange so präsent in den Medien. War das zu viel oder berechtigt?
Dölken: Wäre Corona vor 100 Jahren aufgetreten, wären die Gesundheitssysteme komplett überlastet worden, mit Millionen von Toten wie bei der Spanischen Grippe 1918. Wir hatten in den ersten Wellen 2020 und 2021 eine Inzidenz von 500, und es wurde bereits kritisch in unseren Krankenhäusern. Bei Omikron haben wir gesehen, dass Inzidenzen leicht in die Tausende gehen können. Wir hatten keine andere Wahl, als harte Maßnahmen zu ergreifen – auch wenn das einige Leute nicht wahrhaben wollten. Die gute Nachricht ist aber, dass die Inzidenzen nicht viel höher gehen können, als wir es in der ersten Omikron-Welle gesehen haben. Wenn eine Virusvariante mehr als zehn Prozent der Bevölkerung pro Woche infiziert, ist der Großteil der Menschen in wenigen Wochen gegen diese Variante immun. Trotzdem: Eine Übersterblichkeit gab es in Deutschland 2020 und 2021 nur aufgrund der harten Lockdowns nicht.

Und wie ist es jetzt? Das Virus hat sich verändert, wir sind in einer anderen Phase der Pandemie. Muss man mit Corona heute anders umgehen?
Dölken: Den nächsten Schritt hatte Herr Lauterbach bereits im Frühjahr vorgeschlagen – die Aufhebung der Isolationspflicht bei Corona. Es könnte aber ohne weiteres sein, dass die Influenzawelle diesen Winter schlimmer wird als Corona. Für Influenza besteht jedoch keine Isolationspflicht. Wichtiger als eine virusspezifische Isolationspflicht, die vielleicht nur von einem Viertel bis einem Drittel aller Infizierten umgesetzt wird, da die anderen von ihrer Infektion gar nichts wissen, wäre daher ein konsequentes Vermeiden von Kontakten bei grippalen Symptomen.
Könnte und sollte die Isolationspflicht also schon in diesem Winter fallen?
Dölken: Wenn wir nur Corona hätten, würde ich sagen: ja. In der Kombination mit einer drohenden schweren Influenzawelle, ist es aber wohl sinnvoller, hiermit noch zu warten. Wie der kommende Winter verläuft, wird wesentlich davon abhängen, ob und wie sehr Influenza- und Corona-Welle zusammentreffen. Sollten sich beide Wellen gleichzeitig aufbauen, wird es wohl in den Krankenhäusern erneut kritisch. Anders ausgedrückt: Corona ist erst dann vorbei, wenn wir einen ganzen Winter ohne Kontaktbeschränkungen durchgekommen sind. Dann kann beziehungsweise sollte wohl auch die Isolationspflicht für Corona fallen. Corona und Influenza wären dann gleichstellt.
