Es ist Festivalsaison in Unterfranken: Beim Mozartfest (noch bis 23. Juni) und Kissinger Sommer (21. Juni bis 21. Juli) geben sich die großen Orchester die Klinke in die Hand. Immer wieder fällt Zuhörerinnen und Zuhörern dabei auf, wie unterschiedlich die Sitzordnungen sein können. Enrico Calesso, Generalmusikdirektor des Philharmonischen Orchesters Würzburg, erklärt, wie über die Jahrhunderte die Aufstellung zustande kam. Und warum es neben der Konstante "Streicher vorne, Bläser hinten" Variationen und Vorlieben gibt.
Im Konzert fällt auf, dass Orchester unterschiedlich sitzen, auch wenn sie die gleichen Werke spielen. Wovon hängt das ab?
"Das ist eine der wichtigsten Entscheidungen, die man treffen muss", sagt Enrico Calesso. Es gebe drei Kriterien. Zunächst die Komposition selbst: In der Klassik seien die ersten und zweiten Geigen oft im Dialog. "Wenn man dieses Wechselspiel herausarbeiten will, setzt man erste und zweite Geigen einander gegenüber. Wenn sie aber viele gemeinsame Passagen haben, setzt man sie nebeneinander." Bei Brahms zum Beispiel gebe es Beispiele für beide Versionen.
Zweites Kriterium: der Klang. "Wenn die Geigen rechts vorn sitzen, geht ihr Klang nach hinten, das muss man bedenken", so der Dirigent. Auch müsse man entscheiden, ob man die Kontrabässe teile und rechts und links aufstelle. Damit die tiefen Töne nicht nur von einer Seite kommen. Dass die Celli gelegentlich rechts außen sitzen, hat historische Gründe, erklärt Enrico Calesso. Man nenne das die "Stockowski-Aufstellung", nach dem Dirigenten Leopold Stokowski (1882-1977). "Er führte die Sitzordnung in den 1920er Jahren ein, weil er fand, dass die Streicher dann einander besser hören könnten. Das war außerdem bei Plattenaufnahmen günstiger, weil man dann die Kanäle besser trennen konnte."
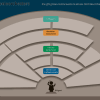
Welche Rolle spielen der Saal oder der Graben in der Oper?
Das dritte Kriterium: der Saal oder der Graben und seine Akustik. "Wenn die Bühne aus Podesten besteht, wie im Saal der Musikhochschule, muss man aufpassen, dass man die Gruppen nicht auseinanderreißt", so Calesso. Und wenn der Graben, wie in Leipzig oder in der Blauen Halle, breit und wenig tief ist, müsse man Blechbläser auf die eine Seite und Holzbläser und Hörner auf die andere setzen. Und dazwischen dann die Streicher. "Manchmal zwingt der Saal auch dazu, die Holzbläser alle in eine Reihe zu setzen. Das ist nie ganz befriedigend."
Welche Kriterien haben Komponisten, wenn sie entscheiden, welche Instrumente sie einsetzen?
"Das ist immer vom Werk und vom angestrebten Klang abhängig", sagt Calesso. Bei Beethoven zum Beispiel kämen Posaunen eher selten vor. Und in der "Eroica" setze er drei Hörner ein, das sei sehr ungewöhnlich. "Man muss wissen, dass vor allem die Blechblasinstrumente damals ganz anders klangen als heute. Sie hatten keine Ventile."
Mit der Zeit sei dann das Spektrum technisch und vom Tonumfang her erweitert worden. Im 19. Jahrhundert bekamen die Instrumente immer mehr Klangvolumen. "Richard Wagner war ein wichtiger Antreiber", sagt Calesso, "besonders für die tiefen Töne". So seien Wagner-Tuben und Kontrafagott entstanden. Und dadurch wiederum hätten die Komponisten angefangen, anders zu komponieren.

Ist es für den Dirigenten ungewohnt, wenn er unterschiedliche Aufstellungen leitet?
"Das ist es. Man muss sich deshalb gut vorbereiten", meint Calesso.
Haben die Musikerinnen und Musiker Vorlieben, wo sie sitzen?
"Natürlich. Aber sie sind immer so professionell, dass sie sich anpassen, wenn es nicht so angenehm ist", so der Dirigent. Für erste und zweite Geigen sei es immer problematisch, wenn sie einander gegenübersitzen. Das habe für die Interpretation Vorteile, aber es sei eine große Leistung der Musikerinnen und Musiker. "Entspannter ist es, wenn sie nebeneinander spielen können."

Seit wann sprechen wir eigentlich von einem "Orchester"?
Es gab immer schon Ensembles in unterschiedlichen Besetzungen, aber erst seit der Barockzeit sprechen wir von einem "Orchester", erläutert Enrico Calesso. Das habe mit der Entwicklung des Streicherapparats zu tun: Geigen, Bratschen, Celli, Kontrabässe setzten sich als Standard durch, Gamben, die es in unterschiedlichen Größen und Stimmungen gab, verschwanden allmählich. Ein Irrtum sei übrigens, so Calesso, dass damals die Ensembles eher klein gewesen seien: "Haydns Konzerte in London fanden zum Teil mit riesigen Besetzungen statt."
Haydn in London, Händel in London und in Italien: Gab es unterschiedliche Stile in den Ländern?
"Wir wissen, dass Händel, als er für seine Oper 'Rinaldo' in Italien war, selbst vor dem Orchester die Geige in die Hand genommen hat, um zu zeigen, welchen Stil, welchen Gusto er haben wollte", sagt Calesso. So hätten sich gewisse Schulen gebildet. Etwa die Mannheimer Schule, die in Mozarts Werk eine große Rolle spielt. Deren Einfluss sei im "Idomeneo" zu erkennen. Und über die Schulen kam es dann auch zu festen Orchesterbesetzungen. "Bis heute achten Orchester sehr genau darauf, dass Bewerberinnen und Bewerber vom Stil her zu ihnen passen", so Calesso, "damit ein ganz bestimmter Klang, den man anstrebt, erhalten bleibt."
