In Würzburg heißen sie „Auflauf“, „Jenseits“, „Schelmenkeller“ oder „Zauberberg“. Oder „Weinhaus Schnabel“, „Walfisch“, „Achtele“ und „Semmelbrösel“. In Schweinfurt gab und gibt es das „Café Maul“, das „Münchner Kindl“, den „Korkenzieher“ und „Pussycat“. In Lohr geht? in die „Goldene Krone“, in Bad Kissingen sitzt man in der „Umkehr“, in Frickenhausen trinkt man den Schoppen im Gasthaus „Zum Bären“.
„Da kann man die Vielzahl der deutschen Gasthausnamen schon erahnen“, sagt Gunther Schunk. Und zählt weiter auf: „Löwe“ in Marktbreit, „Goldenes Faß“ in Würzburg, „Hirschkeller“ in Schweinfurt. „Bei der Benennung von kostenpflichtigen Verkostungsorten gibt es kaum Grenzen!“, sagt Schunk. Ging der Großvater früher noch in die „Krone“ um sein Bier zu trinken, schlürft der Enkel seinen Caipi oder das Bananen-Weizen im „Papperla Pub“.


Gunther Schunk, selbst Kneipengänger in Würzburg, hat irgendwann angefangen, genauer hinzuschauen. Und zu fragen, wie so eine Lokalität eigentlich zu ihrem Namen kam. Würde heute noch jemand sein frisch eröffnetes Restaurant „Zum Grünen Kranze“ nennen? Und wäre vor 100 Jahren ein Wirt auf die Idee gekommen, seine Trinkstube „Sonderbar“ oder „Na und?“ zu taufen?
"Bei der Benennung von kostenpflichtigen Verkostungsorten gibt es kaum Grenzen!"
Dr. Gunther Schunk, Sprachwissenschaftler und Kneipengänger aus Würzburg
Die Veränderungen in der Gasthausnamen-Wahl sind unverkennbar – wie man sein Restaurant benennt, ist eine Frage der Mode und Zeit. Sprachwissenschaftler Schunk, der aus Coburg stammt und an der Uni Würzburg studiert und promoviert hat, wollte mehr darüber wissen. 1998 hatte er bereits einen Kneipenführer geschrieben und vier Jahre später überarbeitet, „Würzburg zwischen Sekt & Selters“. Und angeregt von einem Namenskunde-Seminar einst zu Studienzeiten hielt er immer wieder mal irgendwo einen Vortrag über die Bezeichnungen wie „Rock-a-Hula-Bar“, „Biertümpel“ oder „Walfisch“. Mit Heimatpflegerin Birgit Speckle vom Bezirk Unterfranken war er in Dorfwirtschaften unterwegs, um über die Namen der Lokalitäten zu reden. Nur – was war die echte Geschichte hinter diesen Namen?
So sieht es in der gastronomischen Szene in Schweinfurt und Würzburg aus
„In den wenigsten Fällen habe ich herausgefunden, woher der Name kommt“, sagt der Dialektologe und Autor, der hauptberuflich bei der Vogel Communication Group in Würzburg als Chief Communications Officer tätig ist. Oft gebe es schlicht keine Erklärung und Begründung dafür. „Es muss Motive geben, die total einleuchtend sind – aber sie sind nicht schriftlich dokumentiert und nicht verbürgt.“

Angeregt von seinem ehemaligen Uni-Kollegen Dr. Jens Wichtermann, der schon Daten gesammelt hatte, machte sich der 53-Jährige auf und nahm eine Stichprobe der Gasthausnamen in den größten beiden Städten Unterfrankens: Quasi in einem kleinen „Wirtschaftsstudium“ wollte Schunk die gastronomische Szene in Schweinfurt und Würzburg namenkundlich und sprachwissenschaftlich begutachten. Wann waren welche Bezeichnungen besonders beliebt? Wie oft gibt es Gasthäuser „Zur Krone“? Warum heißen Kneipen und Bars „Schabernack“ oder „Zur Gemütlichkeit“, aber nicht „Zum traurigen Landmann“? Was das „Papperla Pub“ mit dem „Goldenen Stern“ zu tun hat? Und was verbirgt sich hinter „M.u.C.K.“ und „Chambinzky“?
"Wieso 'Zum Udo' so heißt, ist klar."
Kneipennamen-Forscher Gunther Schunk
„Wieso ,Zum Udo' so heißt, ist klar“, sagt Schunk, seit 2003 Vorsitzender des Würzburger Zweigs der Gesellschaft für deutsche Sprache und seit 2014 im Kulturbeirat der Stadt. Er selbst sei immer „Zum Werner“ gegangen, wenn er sich im „Schelmenkeller“ mit Kollegen und Freunden auf ein Bier traf.
Die Quellen, die Schunk für seine kleine Untersuchung über die Namen der hiesigen Speiselokale, Wirtshäuser, Gasthöfe, Weinhäuser, Schänken, Trinkstuben, Imbisse und Etablissements nutzte? Vornehmlich Schweinfurter Adress- und Telefonbücher und verschiedene Schriften über Würzburg, wie der erste Reiseführer von 1803. Aus dem Mittelalter, als die Gastronomie allmählich begann, gebe es kaum Dokumente über Gasthäuser. Viele Kneipen, Schänken, Spelunken hätten keinen offiziellen Namen getragen – oder bestenfalls eine Hausnummer. Und manches Wirtshaus nennt voller Stolz sein Gründungsjahr.
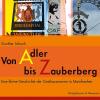
Erst ab dem 18. Jahrhundert, sagt Schunk, ließen sich Gasthausnamen in Verzeichnissen feststellen, umfangreiche städtische Dokumentationen gibt es dann ab dem 20. Jahrhundert. Die Erkenntnisse seiner kleinen Wirtshausforschung hat der Würzburger jetzt in einem Buch zusammengefasst: „Von Adler bis Zauberberg – Eine kleine Geschichte der Gasthausnamen in Mainfranken“. Keine Geschichte der Gasthäuser, betont der Autor. Und kein vollständiges Verzeichnis aller Lokalitäten der beiden Städte oder gar Unterfrankens. Sondern eine kleine Spurensuche und ein exemplarischer Überblick über Typen, Moden und Trends.
Ob „Brückenbäck“ oder „Zollhaus“ oder „Zur Post“: Eine Grundbedingung gibt es für alle Kneipennamen, sagt Schunk. „Sie sollen – pro Ort – einmalig sein, unverwechselbar und eben eindeutig identifizierbar.“ Einen „Goldenen Stern“ darf es nur einmal im Dorf und in der Stadt geben – wie sollte man sich sonst dort mit jemandem verabreden. Häufig in Mainfranken: die „Linde“, die „Krone“ und der „Goldene Stern“. Das traditionsreiche „Wirtshaus Holzapfel“ in der Würzburger Klinikstraße, Gründungsjahr 1806, ist da schon einmaliger. Und es hat einen echten Spitznamen: „Nabelschnur“. Weil sich nebenan früher die Universitätsfrauenklinik befand – mit der Entbindungsstation. Die werdenden Väter hielten sich tapfer wartend in der Gaststätte „Holzapfel“ am Bier fest.
Der Lifestyle der jeweiligen Zeit prägt auch die Wirtshausnamen
Skurril und kreativ wurde es in der Gastro-Szene ab den 1960ern, 1970ern, als Diskos und immer mehr Kneipen aufkamen. Das „Jenseits“ gibt es seit Ende der 1980er Jahre – „zuvor hat man damit keine Witze gemacht“. In den 1990ern und nach der Jahrhunderwende „ist es dann explodiert“, sagt Schunk schmunzelnd mit Verweis auf den „Lifestyle“. In seinem Buch macht er am Ende selbst ein paar Vorschläge für zukünftige Wirte im Stil der Zeit: „Abfüll-Bar“, „Unfass-Bar“, „Lös-Bar“ oder „Suppenkas-Bar“ – und „Zum Wohl“. Für den Sprachwissenschaftler, Kommunikationsexperten und Dialektologen sind Wirtshausnamen ein Stück Kulturgeschichte und Fenster in die Vergangenheit.

Eine Zeit lang, im 17. oder 18. Jahrhundert, seien Tiernamen beliebt gewesen – da kamen die „Ochsen“, „Bären“ und „Adler“ und das „Lamm“. Berufsbezeichnungen – „Postkutscherl“ oder „Winzermännle“ – kamen im 19. Jahrhundert dazu.

Wichtig sei es wohl gewesen, dass man den Namen gut aufs Wirtshausschild malen konnte. Egal ob kunstgeschmiedeter Ausleger, Schild oder Neonreklame – Symbole spielten von Anfang an eine wichtige Rolle bei der Gasthof-Taufe. „Sonne“, „Rose“, „Anker“ – auch die Heraldik, die Wappenkunde, nahm auf Schänken und Wirtschaften Einfluss.


Wieso anno 1880 eine Gaststätte „Zur Erholung“ nennen? „Auch ein Zeitgeist-Ausdruck“, sagt Schunk, „so was macht heute keiner mehr.“ Familienname des Besitzers, Name der Wirtin, die Lage und der Ort, die betreibende Brauerei, Berufsbezeichnungen, Abstraktionen – zwölf Namensgruppen hat Schunk in seiner Typologie insgesamt ausgemacht. Das Würzburger „M.u.C.K.“ übrigens stehe für „Martinas und Christians Kneipe“, schreibt der Namensforscher. Warum der „Walfisch“ allerdings „Walfisch“ heißt, war nicht mehr auszumachen.

Dass seine Namenskunde gerade jetzt erscheint, wo niemand am Stammtisch sitzen kann und am Tresen nichts gezapft werden darf? „Stell Dir vor, sie kommen nicht mehr zurück?“, fragt der 53-Jährige halb-ernst. Im Buch ist er optimistisch: „Egal wie sie heißen werden, auch in Zukunft werden Gasthäuser Namen haben und Orte der Geselligkeit sein.“
Buchtipp: „Von Adler bis Zauberberg. Eine kleine Geschichte der Gasthausnamen in Mainfranken“, von Gunther Schunk unter Mitarbeit von Lena Gerhard nach einer Idee von Jens Wichtermann, Verlag Königshausen & Neumann Würzburg, 96 Seiten, 16,80 Euro

