500 Jahre Bauernkrieg: Wer bei all den Gedenkveranstaltungen, Theaterstücken oder Lesungen wissen möchte, was denn eigentlich passiert ist, was die Aufständischen antrieb, wie die Obrigkeit reagierte und wie das Ganze schließlich ausging, wer sich also einen Überblick über die turbulenten und eben nicht immer übersichtlichen Ereignisse des Jahres 1525 verschaffen möchte, der ist im Museum für Franken auf der Würzburger Festung Marienberg gut aufgehoben.

Unter dem Titel "1525 – Franken fordert Freiheit*en" hat die Historikerin Teresa Novy mit wenigen, sorgfältig zusammengestellten Exponaten, Mitmach-Stationen, darunter ein eigens entwickeltes Computerspiel, und knappen, klaren Texten eine Ausstellung kuratiert, die für Erwachsene ebenso lehrreich sein dürfte wie für Kinder und Jugendliche.

Eindrucksvoll schon die Erkenntnis, die Besucher und Besucherinnen gewinnen können, wenn sie die Apparatur gleich am Eingang bedienen, die entfernt an eine Sanduhr erinnert. Die von Novy erdachte Station fordert auf, die Höhe der Abgaben zu schätzen, die auf den Bauern lasteten. Dazu soll man eine bestimmte Menge an bunten Plastikstückchen durchrieseln lassen und dann den Fluss unterbrechen: Unten häufen sich die Abgaben, oben das, was behalten werden durfte.
Franken war alles andere als ein einheitliches Herrschaftsgebiet
"Alle schätzen die Abgaben zu niedrig ein", sagt Novy, und erklärt, dass die Bauern in Jahren schlechter Ernten, die zu Beginn des 16. Jahrhunderts häufig waren, bis zu 70 Prozent ihrer Erträge bei ihren Landesherren abliefern mussten. Und solche gab es unüberschaubar viele: Eine Karte zeigt, dass Franken alles andere als ein einheitliches Herrschaftsgebiet war.

Wirtschaftliche Not und völlige Rechtlosigkeit, dazu eine Stimmung des Wandels, befeuert durch Luthers Reformation, die die Macht der Kirche ins Wanken brachte, und die Entdeckungen in Übersee - all das trug dazu bei, dass irgendwann der Funke übersprang. Dass sich, nach etlichen lokalen Erhebungen, im Jahr 1525 vom Allgäu aus über Franken und bis Thüringen eine vernetzte Bewegung bildete, die zunächst nur Gewalt gegen Sachen ausübte, sprich: plünderte und zerstörte.

Beteiligt waren durchaus nicht nur Bauern und nicht nur Männer, sondern auch Handwerker, Intellektuelle und vereinzelt auch Adlige wie Florian Geyer, weswegen der Begriff Bauernkrieg heute als überholt gilt. "Wir sprechen heute von Aufständischen", sagt Teresa Novy. Ihre Forderungen hielten sie in den berühmten "Memminger 12 Artikeln" fest: unter anderem Senkung der Abgaben, Abschaffung des adeligen Jagd- und Fischereiprivilegs sowie das Recht zur Wahl und Abwahl des Gemeindepfarrers.

In der Ausstellung zeigt ein "Beutewagen", was alles mitgenommen wurde: Zinngeschirr, Dachziegel, Pelze, Federbetten, Glasscheiben - eben alles, was Adel, Klerus und den reicheren Stadtbewohnern vorbehalten war. Den Städten und ihrem Schlingerkurs gegenüber den Aufständischen, die übrigens nicht schlechter bewaffnet waren als die Soldaten der Herrschenden, widmet die Ausstellung eine eigene Abteilung.
Die Obrigkeit, die sich massiv gefährdet fühlte, schlug brutal zurück
Obwohl in der Anfangsphase keine Menschen zu Schaden kamen, erkannte die Obrigkeit, die sich massiv gefährdet fühlte, auf "Hochverrat" und "Landfriedensbruch", und schlug brutal zurück. Das Ergebnis ist bekannt: Die Aufstände wurden niedergeschlagen, die Beteiligten hart bestraft. In Würzburg wurden etwa 100 Menschen hingerichtet, in ganz Franken 1000.
Auch der Bildschnitzer Tilman Riemenschneider gehörte zu den Verhafteten. Er wurde mehrere Monate eingesperrt und gefoltert. Dass ihm dabei die Hände gebrochen wurden und er deshalb seine Werkstatt seinem Sohn übergeben musste, hält Teresa Novy für eine Legende: "Er hatte kaum mehr Aufträge, weil sein Stil aus der Mode gekommen war. Inzwischen hatte die Renaissance die Gotik abgelöst."
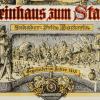
Obwohl die Ausstellung vor allem Hintergründe und Lebenswirklichkeiten zeigen will, zeigt "1525 – Franken fordert Freiheit*en" natürlich auch einige Waffen, darunter ein Richtschwert und einen Ketten-Morgenstern. Ein solcher ist übrigens bis heute im Ausleger eines Würzburger Gasthauses zu sehen, das den Aufständischen als Quartier diente. Daher hat es auch seinen Namen: "Zum Stachel".
Wie sehr sich der Blick auf das Geschehen zurück verändert hat, zeigen zwei neuzeitliche Exponate: Ein Kalenderblatt von 1909 verherrlicht Sebastian von Rotenhan, Vertreter der Obrigkeit, als strahlenden Helden, auf einer Speisekarte des "Stachel" aus den 1960er Jahren sind dagegen die Aufständischen die Helden.
Museum für Franken: "1525 – Franken fordert Freiheit*en", bis 26. Oktober. Geöffnet: Di.-So, 10-17 Uhr. Begleitprogramm unter www.museum-franken.de
