Bei Steffen Barthel dreht sich vieles um Fußball. An Wochenenden steht der 29-Jährige als Spielertrainer für seinen Heimatverein Gelchsheim in der Kreisliga Würzburg 1 auf dem Platz, die Woche über beschäftigt er sich beruflich mit dem runden Leder, dann eher theoretisch.
Seit Juni vergangenen Jahres arbeitet Barthel als wissenschaftlicher Mitarbeiter am "TSG ResearchLab", einer gemeinnützigen Tochtergesellschaft des Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim im baden-württembergischen Zuzenhausen, nur fünf Autominuten entfernt vom Dietmar-Hopp-Stadion im Sinsheimer Stadtteil Hoffenheim.
Daten sind im Profi-Fußball längst unverzichtbar geworden
Ziel der Einrichtung ist es, zu Zukunftsthemen in Sport und Gesellschaft zu forschen. Im Bereich Fußball geht es speziell darum, Talente auf Basis von Daten zu entwickeln. "Zu einem Fußballspiel können heutzutage Millionen solcher Daten erhoben werden", sagt Barthel. Torschüsse, Laufleistung oder Zweikampfquote.
"Das sind aber nur Basisdaten", erklärt der frühere Bayern- und Landesliga-Spieler des Würzburger FV 04 und des TSV Abtswind. In der modernen Fußball-Welt ist das Datennetz längst viel weiter gespannt. Die inzwischen wohl bekannteste Innovation in dieser Werkzeugkiste ist der sogenannte "Expected-Goals-Wert" (xG), der die Wahrscheinlichkeit eines Torerfolgs anhand von vergleichbaren Spielszenarien aus der Fußball-Historie misst.

Mit sogenannten "Eventdaten" beschäftigte sich Barthel auch schon während seiner Zeit als Mitarbeiter beim Zweitligisten Greuther Fürth im Jahr 2021. Dort war der studierte Sportökonom verantwortlich für die Datennutzung für Spielanalyse und Scouting. Diese "Zahlenspielereien" sind im Millionengeschäft Profi-Fußball längst zu einem unverzichtbaren Mittel geworden: So wenig wie möglich soll dem Zufall überlassen werden, um die Wahrscheinlichkeit des sportlichen Erfolges zu erhöhen. Doch wie kommen Vereine an diese Informationen?
Bei Greuther Fürth für die Analyse von Spielerdaten zuständig
"Die Daten, die Erst- und Zweitligisten betreffen, bekommen die Klubs von der Deutschen Fußball Liga (DFL) kostenlos zur Verfügung gestellt. Wollen Vereine aber international Spieler scouten, müssen sie die Daten von externen Dienstleistern kaufen", erklärt Barthel. Der Gelchsheimer analysierte diese Daten für die Fürther.
Die daraus entstandenen Ergebnisse ließen sich auf zwei Arten nutzen: Trainer erhielten einen besseren Einblick in die Leistungen der eigenen Spieler, Spielbeobachter griffen auf sie zurück, um potenzielle Neuzugänge für den Zweitligisten unter die Lupe zu nehmen.
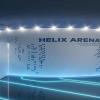
"Die Daten sind zusätzliche Informationsquellen, die man nutzen kann, um bessere Entscheidungen zu treffen", sagt Barthel. Zudem hätten sie den Vorteil, "dass man nicht 50 Scouts braucht, die weltweit Spiele anschauen".
Rundum-Bildschirm stellt Situationen aus Fußball-Spielen nach
Am "TSG ResearchLab" ist der 29-Jährige aktuell in einem Projekt tätig, das sich mit "taktischem Lernen und Entscheidungsfindung im Fußball" befasst. Dies soll bei Spielern durch videobasiertes Training gefördert werden. Dafür sorgt "Helix", ein 360-Grad-Bildschirm: Die Spielerin oder der Spieler steht in der Mitte und muss in Echtzeit auf die dargestellten Spielszenen reagieren.
"Es geht darum, Spielsituationen nachzustellen und dadurch die Entscheidungsfindung und Wahrnehmung von Spielern zu verbessern", fasst Barthel den Nutzen der komplexen Maschine zusammen. Das Besondere an diesem Projekt, zu dem Barthel auch parallel an der Freien Universität Amsterdam promoviert, ist die Entwicklung einer Spielsimulation, die sich noch näher am realen Fußball-Geschehen bewegt.

Auf Basis von Skelettdaten, mit denen sie vom kleinen Zeh bis zum Ohr dreidimensional dargestellt werden, können Spielerinnen und Spieler in Situationen hineinversetzt werden, die tatsächlich in einem Fußball-Spiel so abgelaufen sind. Daraus werden wiederum neue Daten gewonnen, die beispielsweise die Körperorientierung und das Blickverhalten eines Spielers während einer Aktion optimieren sollen. Wie sich die gewonnenen Erkenntnisse auf die Gestaltung des Trainings und die Entwicklung von Talenten auswirken, untersucht Barthel im Rahmen seiner Promotion.
Konzepte für die Trainerausbildung auf Landesebene entwickelt
Für ihn sei dieses Feld spannend und näher am eigentlichen Fußball als bei seiner vorherigen Tätigkeit als Bildungsmanager beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) in Frankfurt. Dort hatte Barthel knapp zwei Jahre lang Konzepte für die Trainerausbildung auf Landesebene entwickelt. "Das war eine Management-Stelle, ich wollte aber wieder näher am Sport selbst sein. Das macht mir mehr Spaß als das Organisatorische", erklärt der Sportwissenschaftler.
Dass ein derart wissenschaftlicher Ansatz im Fußball auch Skepsis hervorruft, weiß der 29-Jährige. Talente werden in vorgegebene Schemata gepresst, die ihnen die Freiheit nehmen würden, sich kreativ zu entfalten. Aus Fan-Sicht könne er solche Kritik sogar verstehen, sagt Barthel. " Aber für mich macht die Datenanalyse den Fußball noch spannender und vereinfacht die taktische Analyse."
Als Spielertrainer in seinem Heimatverein könne er manches Wissen aus dem Beruf anwenden: "Ich fände es naiv, wenn Vereine die Möglichkeiten, die es heute gibt, nicht nutzen würden." Als wissenschaftlicher Mitarbeiter befasse er sich noch viel intensiver damit, wie Spielerinnen oder Spieler lernen und wie er ihnen als Trainer durch sein Feedback helfen könne.
Drei Tipps für besseres Training im unteren Amateurbereich
Barthel könne Kolleginnen und Kollegen empfehlen, so "spielnah" wie möglich zu trainieren. Er lasse deshalb – bis auf ein kurzes Aufwärmen – nicht ohne Ball und Gegenspieler trainieren. Ebenso sollten Trainer mehr "laufen" lassen: "Wir geben als Trainer oft zu viel Feedback während des Spiels und nehmen den Spielern so Entscheidungen ab. Sie spielen dadurch zwar besser, lernen aber nicht dazu." Das gelte vor allem bei Kindern und Jugendlichen. Und gerade im Amateurbereich müssten Trainer auf die Belastung der Spieler achten: "Wir trainieren mittlerweile deutlich kürzer, vor allem im Abschlusstraining."
