Der Philosoph und Autor Rüdiger Safranski, Jahrgang 1945, beschäftigt sich immer wieder mit grundsätzlichen Fragen. Es hat über die Zeit geschrieben und über die Wahrheit. Seine Bücher, die sich immer wieder auch mit der deutschen Kultur- und Geistesgeschichte auseinandersetzen, werden in 26 Sprachen übersetzt. Aus seinem jüngsten Werk "Einzeln sein - eine philosophische Herausforderung" (Hanser) wird er am 21. März beim Literaturfestival MainLit lesen.

Sie sehen das Einzeln sein als Chance, aber auch als Herausforderung. Im Moment scheint mir eher das Schreckgespenst der Einsamkeit eine Rolle zu spielen.
Rüdiger Safranski: Das ist die alte Frage der Autonomie. Für Einsamkeit gibt es viele Gründe. Einer davon ist, dass man es bei sich selbst nicht aushält. Die Fähigkeit, von sich selbst nicht gelangweilt zu werden, ist eine wichtige Voraussetzung, nicht einsam zu sein. Sie zu lernen, birgt viele Chancen. Einsam ist man, wenn man auch von sich selbst alleingelassen wird. Das kann geschehen, auch wenn man unter Menschen ist.

Hannah Arendt spricht vom Wunder des Anfangens. Das mit sich selbst etwas anfangen Können scheint aber immer mehr verloren zu gehen.
Safranski: Ja, und das ist schade. Wir sind gesellschaftliche Wesen, wir brauchen Gesellschaft, das ist klar. Aber wenn man in Panik vor sich selbst in die Gesellschaft flieht, ist das auch für die Gesellschaft nicht besonders gut. Am schönsten ist es, wenn man in Übereinstimmung mit sich in Gesellschaft ist.
"Es ist entscheidend, dass man Auszeiten von der technischen Kommunikationswelt nimmt."
Rüdiger Safranski zum Thema innere Mitte
Sie beschreiben die paradoxe Gleichzeitigkeit von Vereinzelung und Schwarmverhalten, in der wir leben. Was können wir tun, um da rauszukommen?
Safranski: Da gibt es keine billigen Rezepte. Man muss in der Erziehung früh die Kräfte stärken, die es einem jungen Menschen erlauben, in sich selbst zu ruhen. Dabei ist entscheidend, dass man Auszeiten von der technischen Kommunikationswelt nimmt. Dass man lernt, Dinge alleine zu tun, Lesen etwa. Es macht mir große Sorgen, wenn ich höre, dass sich junge Menschen sechs, sieben, acht Stunden in den neuen Medien aufhalten. Da frage ich mich: Was passiert mit dem eigenen Mittelpunkt, wenn man dauernd online ist?

Man muss sich ja vielleicht nicht gleich wie Henry David Thoreau im 19. Jahrhundert in eine einsame Blockhütte zurückziehen.
Safranski: Ich habe ja kein Ratgeberbuch geschrieben. Sondern ich will mit der Schilderung von Figuren, die das Einzeln sein für sich zum Thema gemacht haben, Lust darauf machen.
Diderot sagt, man muss im Miteinander auch Dissonanzen aushalten können. Ist das nicht auch heute in zentrales Problem?
Safranski: Genau das ist der Punkt. Deswegen ziehen wir uns auch in Blasen zurück, in denen Einstimmigkeit herrscht. Differenzen der Meinungen und der Temperamente aushalten zu können, ist ganz wichtig. Wenn man es mal eine Weile versucht hat, merkt man, dass die Wirklichkeit reicher wird. Da gibt es viele Farben. Es wird so viel von Diversität geredet, aber in Wirklichkeit hat man dazu gar kein entspanntes Verhältnis, sondern zieht sich auf seine jeweilige Ingroup zurück.
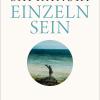
Sie porträtieren viele Denkerinnen und Denker und ihre ganz unterschiedlichen Verhältnisse zum Einzeln sein. Welcher Weg ist ihnen denn am nächsten?
Safranski: All diese Figuren haben etwas Bedenkenswertes. Aber wer mir besonders am Herzen liegt, ist Michel de Montaigne (1533-1592), obwohl der schon ein paar Jahrhunderte zurückliegt. Er ist wirklich großartig. Und ganz einfach: Man muss sich ab und zu ins Hinterstübchen zurückziehen, um mal zu überlegen, was man selber denkt, und nicht was allgemein empfunden und gedacht wird. Er plädiert auch nicht für eine prinzipielle Verfeindung mit der Gesellschaft, sondern dafür, das Gesellschaftliche zu nutzen, aber dabei immer zu wissen, wo der eigene Mittelpunkt ist. Was auch sehr weise ist: Es gibt nicht den einen unveränderlichen Kern des Ich. Man muss beweglich in sich selbst sein. Sich auch mal von sich selbst überraschen lassen.
Das Heilsversprechen der Selbstfindung, der Selbstverwirklichung, der Selbstoptimierung erscheint dagegen eher wie ein direkter Weg in den Narzissmus.
Safranski: Das mit dem ganz festen Kern ist sicher eine falsche Erwartung. Wir können uns nicht absolut festlegen. Wir machen zwar Treueversprechen und setzen damit auf Kontinuität, aber wir müssen wissen, dass wir uns nicht von Natur aus auf diese Kontinuität verlassen können. Es scheitern so viele Ehen, weil sich Menschen auseinanderentwickeln. Wenn man dann sagt, man will treu bleiben, ist das eine achtenswerte Entschlossenheit. Das heißt natürlich auch, dass man die Veränderlichkeit in der anderen Person annimmt.
"Wenn man will, lassen einem die Neuerungen der technischen Kommunikation sehr viele Chancen."
Rüdiger Safranski ist gegen eine Dämonisierung der neuen Medien
Solon sagt im 7. Jahrhundert v. Chr., der Einzelne sei ein schlauer Fuchs, in der Masse werde er aber zum Schaf oder zum Raubtier. Erschreckend aktuell, oder?
Safranski: Ja. In der Geschichte gibt es immer wieder Phasen, wo das Individuum wichtig wurde, etwa in der italienischen Renaissance. Die Wertschätzung der Einzelperson, denken Sie an die Menschrechte, ist seither in unserem europäischen Kulturkreis tief verankert. Aber nicht unwiderruflich. Es gibt Rückfälle in den schlimmsten Kollektivismus. Denken Sie nur an den Nationalsozialismus, wo es hieß: "Du bist nichts, Dein Volk ist alles". Es gibt immer wieder Versuche, den Individualismus zurückzudrehen. Vielleicht auch, weil Freiheit und Individualismus auch anstrengend sein können. Die Bereitschaft, sich zu unterwerfen, kann deshalb auch immer wieder groß sein, wie etwa zur Zeit in Russland. Es bedarf dann nur eines geschickten Tyrannen. Das alles ist sehr beängstigend. Mut aber macht, dass der Einzelne mit seinem Freiheitswillen letztlich auf ganzer Linie nicht zum Verschwinden gebracht werden kann.
Was kann der Westen dem entgegensetzen? Unsere angebliche Wertschätzung der Einzelperson könnte auch nur ein mit individuellem Konsum verbrämter kapitalistischer Kollektivismus sein.
Safranski: Das ist genau der Punkt. Das Wahre und das Falsche liegt ganz dicht beisammen. Es gibt eine ökonomische Beförderung der Individualkultur, die aber ihrerseits neue Abhängigkeiten erzeugt. Dazu muss man aber sagen: Wenn man will, lassen einem die Neuerungen der technischen Kommunikation sehr viele Chancen. Es ist nicht so, dass wir hier totalitär zugemauert werden. Man kann diese Strukturen nutzen, ohne benutzt zu werden. Ich versuche nicht, defätistisch oder fatalistisch die große Macht dieser Medien zu beschwören, sondern zu sensibilisieren für die Spielräume. Gottlob, wir haben sie noch, die vielen Freiheiten, die wir nutzen können, ein Einzelner zu sein.
Rüdiger Safranski: "Einzeln sein" - Literaturfestival MaiLit, 19.30 Uhr, Gut Wöllried, Rottendorf. Karten unter www.main-lit.de
