Die Hoffnung im Wettlauf, im Kampf gegen das Coronavirus sieht unspektakulär aus – ein bisschen wie die Vitrine im Chemielabor einer Schule. In dem jene seltsamen Kolbenapparate stehen, die irgendwann im 19. Jahrhundert entwickelt wurden, um chemische Reaktionen auszulösen und zu besichtigen. Doch selbst Donald Trump hat höchstes Interesse an diesem Glasschrank, der – was ihm missfallen dürfte – nicht etwa in einer der Wissenschaftshochburgen an der US-Ostküste steht. Sondern auf einem der vielen Hügel rund um die altehrwürdige Universitätsstadt Tübingen auf der Schwäbischen Alb. In einem eher schmucklosen Laborcontainer des deutschen Biotechnologie-Unternehmens Curevac.
Lesen Sie auch:
Trump hat so großes Interesse an dem, was dort passiert, dass er am Montag Curevac-Chef Daniel Menichella in das Weiße Haus einlud, um sich mit ihm (aber auch mit anderen Firmenvertretern) zu treffen. Denn Curevac entwickelt eine faszinierende Abwehrwaffe gegen das sich pandemisch verbreitende Virus. Und Firmengründer Dr. Ingmar Hoerr, inzwischen Aufsichtsratsvorsitzender des 20 Jahre alten Unternehmens, ist sich sicher: „Wir befinden uns in Sachen Corona-Impfstoff in einer Pole-Position. China wird vielleicht bald als Erstes einen Impfstoff entwickelt haben. Aber wir können diejenigen sein, die einen Impfstoff in kürzester Zeit in millionenfacher Dosis herstellen“, sagt der 51-jährige Biologe. Wie das gehen soll? Der Mann, der Jeans und Shirt trägt und vor Energie nur so zu sprühen scheint, antwortet: „Mit einem RNA-Drucker.“
Nicht nur Donald Trump hat größtes Interesse an diesem Drucker, der vielleicht die Befreiung von vielerlei Geißeln der Menschheit sein könnte. Auch Bill Gates hat dem Tübinger Unternehmen, das sich letztlich aus der Doktorarbeit Ingmar Hoerrs entwickelt hat und inzwischen 460 Mitarbeiter an den Standorten Tübingen, Frankfurt und Boston beschäftigt, über seine Stiftung umgerechnet 46 Millionen Euro zukommen lassen. Insgesamt flossen 400 Millionen Euro in das Unternehmen. SAP-Gründer Dietmar Hopp ist über eine Kapitalgesellschaft nun Mehrheitseigner an Curevac, das als klassisches Start-up-Unternehmen im Jahr 2000 begann und heute mit einem Wert von 1,7 Milliarden Dollar beziffert wird.
Fast zeitgleich, tausende von Kilometern östlich: Auf Fotos, die sich am Dienstag rasant in den sozialen Medien Chinas verbreiten, soll Chen Wie, die führende Biochemie-Expertin des Landes, beim ersten menschlichen Test eines Coronavirus-Impfstoffs zu sehen sein. Mit fest entschlossenem Blick steht sie in einem fensterlosen Raum, hinter sich die rote Flagge der Volksrepublik. Die Chinesin trägt Kurzhaarfrisur und eine Camouflage-Uniform. Den rechten Oberarm hat sie hochgekrempelt, damit ihr eine Ärztin im Schutzanzug eine Spritze injizieren kann. Das chinesische Staatsfernsehen spricht mit großen Worten von einem „Durchbruch“ bei der Entwicklung eines Impfstoffs. Doch stimmt das?
Chen Wie leitet eine Einheit von 4000 Medizinern, die ins Epizentrum nach Wuhan entsandt wurden. Die 54-Jährige soll bereits eine Schlüsselrolle bei der Bekämpfung der Sars-Epidemie im Jahr 2003 gespielt haben. Damals habe sie ein Nasenspray entwickelt, das vor der Ansteckung schützte. Es soll sich aber aufgrund der Nebenwirkungen und hohen Kosten nicht zur Massenproduktion geeignet haben. Ob die Wissenschaftlerin nun wirklich einen Durchbruch erzielt hat oder es sich nur um Propaganda handelt, muss sich erst noch zeigen. Das Staatsfernsehen nennt zwar einen sogenannten Adenovirus-Vektor-Impfstoff gegen das Coronavirus. Ein Zeitplan wird aber seltsamerweise nicht erwähnt. Hoffnungen auf einen schnell entwickelten Impfstoff hatte Chen selbst – in einem früheren Interview – als unrealistisch eingestuft.
Das hat gute Gründe. Normalerweise dauert es eine halbe Ewigkeit, bis ein Medikament entwickelt und für den Markt zugelassen wird. In den USA beispielsweise vergehen im Schnitt 14,2 Jahre. Die wichtigsten Zulassungsbehörden für die Medikamente auf der Welt, die amerikanische FDA, die europäische EMA und die japanische MHLW, haben sich schon lange auf gemeinsame Standards geeinigt.
Verkürzt kann man sagen: Nachdem ein Pharmaunternehmen einen Wirkstoff gefunden hat, von dem es meint, dass man es als Medikament herausbringen sollte, wird er zunächst in der Phase I an etwa 80 bis 100 gesunden Probanden getestet. Danach folgt eine Phase II mit wenigen hundert Probanden. Und bei der Phase III geht es um weitere komplexe Studien mit oft vielen tausend Patienten. Sie können sich jahrelang hinziehen. In allen drei Phasen geht es darum, die Wirkung eines Mittels nachzuweisen, seine Nebenwirkungen zu identifizieren und gleichzeitig Gewissheit zu erlangen, dass das Mittel keine Gefahr darstellt. Danach entscheidet – in Europa – die EU-Kommission nach einem rund 200-tägigen Verfahren darüber, ob ein Medikament zugelassen wird.
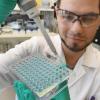
„So läuft das üblicherweise ab“, sagt Ingmar Hoerr. Er ist sich aber sicher: Wenn das Virus in Deutschland völlig außer Kontrolle gerät und ein Hersteller einen Impfstoff hat, der gegen Corona hilft, können die Behörden seinen Einsatz sozusagen aus Notfallgründen für sehr gefährdete Menschen genehmigen. Ob das so stimmt, ist aber unklar. Eine Anfrage unserer Redaktion ließ das Bundesgesundheitsministerium bislang unbeantwortet.
„Das Problem wird weniger sein, den Impfstoff zu entwickeln“, sagt Ingmar Hoerr. Das werde sicher funktionieren. Es gehe eher darum, ihn schnell in millionenfacher Menge bereitstellen zu können. Hoerr blickt in das Innere des RNA-Druckers und weist auf das Herzstück in der Mitte der Anlage. „Das ist sozusagen der Reaktor, in dem wir in kurzer Zeit Millionen Dosen herstellen können.“ Dort befindet sich eine Art Metall-Ei, wenig größer als ein Hühnerei. „Wir haben derzeit einen Tollwut-Impfstoff in der Entwicklung, der bei unseren Probanden sehr gut anschlägt.“ Der Gehalt einer wirksamen Dosis spielt sich im Bereich eines Mikrogramms, also eines Millionstel Gramms, ab. „Wenn es uns gelingt, diese Werte auf den Coronavirus-Impfstoff zu übertragen, können wir in unserer schon existierenden Produktionsanlage in Tübingen pro Zyklus bis zu zehn Millionen Dosen Impfstoff herstellen.“
Und das alles hat mit dem Thema RNA-Drucker zu tun. Er druckt den Impfstoff sozusagen. Ein viel einfacherer Weg als jener, der sonst bei der Herstellung von Impfstoffen beschritten werden muss. Der übliche Weg, eine Infektionskrankheit zu bekämpfen, sieht bekanntlich so aus: Man nimmt den Erreger, schwächt oder tötet ihn ab, spritzt ihn in den Körper – und dieser bildet dann Antikörper. Die Produktion eines solchen Impfstoffes ist aber extrem aufwendig und teuer. Nur ein Beispiel: Üblicher Grippeimpfstoff muss in der Regel mithilfe von Eiern produziert werden. Gemäß einer Faustformel kann man sagen: Aus einem Ei lässt sich nur etwa eine einzige Impfdosis herstellen.
Lesen Sie auch:
„Impfstoffe auf RNA-Basis funktionieren ganz anders“, erklärt Hoerr. RNA (zu Deutsch: Ribonukleinsäure) enthält vereinfacht gesagt die Anweisung, welche Substanz eine Zelle produzieren soll. Das können auch Antikörper sein. Und Curevac ist auf der Suche nach einem RNA-Molekül, das die Zelle veranlasst, einen Antikörper gegen Corona herzustellen.
Wie funktioniert das? Vor Wochen ist die Struktur des Coronavirus, seine sogenannte Gensequenz, von Forschern entschlüsselt worden, die Daten sind weltweit abrufbar. „Deshalb befindet sich das Virus auch nicht in Tübingen. Uns reichen die Informationen über das Virus“, erläutert Hoerr. Curevac hat sich die Struktur angeschaut und RNA-Moleküle hergestellt, von denen das Unternehmen hofft, dass es eben Zellen dazu bringt, jene Antikörper herzustellen, die dann Corona ausschalten können.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Man braucht nur winzige Dosen der RNA-Substanzen. Man spritzt erst gar nicht abgeschwächte oder abgetötete Erreger. Die Immunität entsteht zudem kurz nach der Impfung, weil der Körper ja die Immunantwort nicht erst entwickeln muss, sondern den „genauen und fertigen Bauplan“ ja bereits geimpft bekommen hat. „Und da keine großen Mengen injiziert werden müssen, ist zum Beispiel an der Impfstelle nicht mit Impfreaktionen zu rechnen.“ Man könne auch genau steuern, wie stark das Medikament wirken soll. Bei Tollwut klappe das schon recht gut. Die Krux ist nun freilich, auch für Corona das passende RNA-Molekül zu finden.
Curevac ist nicht das einzige Unternehmen auf der Welt, das auf diesem Gebiet forscht. Ein großer Konkurrent etwa ist das US-Unternehmen Moderna, das ebenfalls auf dem Gebiet der RNA-Technologie tätig ist. Aber natürlich wird auch abseits der RNA-Methodik geforscht. Die Universität von Hongkong behauptet, ähnlich wie ihre Kollegen vom chinesischen Festland, bereits einen Impfstoffkandidaten hergestellt zu haben. Doch dieser müsse noch aufwendig überprüft werden. Unternehmen wie Sanofi wollen aufgrund ihrer Erfahrungen mit der ersten Sars-Epidemie 2003 einen Impfstoff entwickeln. Johnson & Johnson gehen ähnlich vor – auf Basis ihrer Erfahrungen mit Ebola. In Deutschland ist unter anderem auch das Institut für Virologie der Universität Marburg stark mit Forschungsarbeiten befasst.
Im Tübinger Labor von Curevac sind Wissenschaftler beispielsweise damit beschäftigt, RNA-Proben zu testen. Dazu bringen sie die Proben auf einem Satz von jeweils 96 Zellkulturen ein. Kommt es grundsätzlich zu einer Reaktion, erklärt einer der Forscher, schaut man sich die entsprechende Probe genauer an.
Ingmar Hoerr weiß, dass noch viel Arbeit vor seinem Unternehmen liegt. Wie gesagt: Er denkt nicht unbedingt, dass sein Unternehmen als Erstes einen Impfstoff findet. „Wir sind uns aber sicher, dass wir fündig werden. Es ist nur eine Frage der Zeit. Vermutlich braucht man ja einen Impfstoff gegen Corona über viele Jahre hinaus.“
Und mit dem RNA-Printer könne man ja nicht nur Mittel gegen Corona herstellen. Seine Vision ist, eine verkleinerte Version der „Glasvitrine“ etwa in ein Ebolagebiet in Afrika zu fliegen und dort direkt die nötigen Medikamentendosen einfach auszudrucken. Denn es gibt ja nicht nur Corona – als Geißel der Menschheit.
